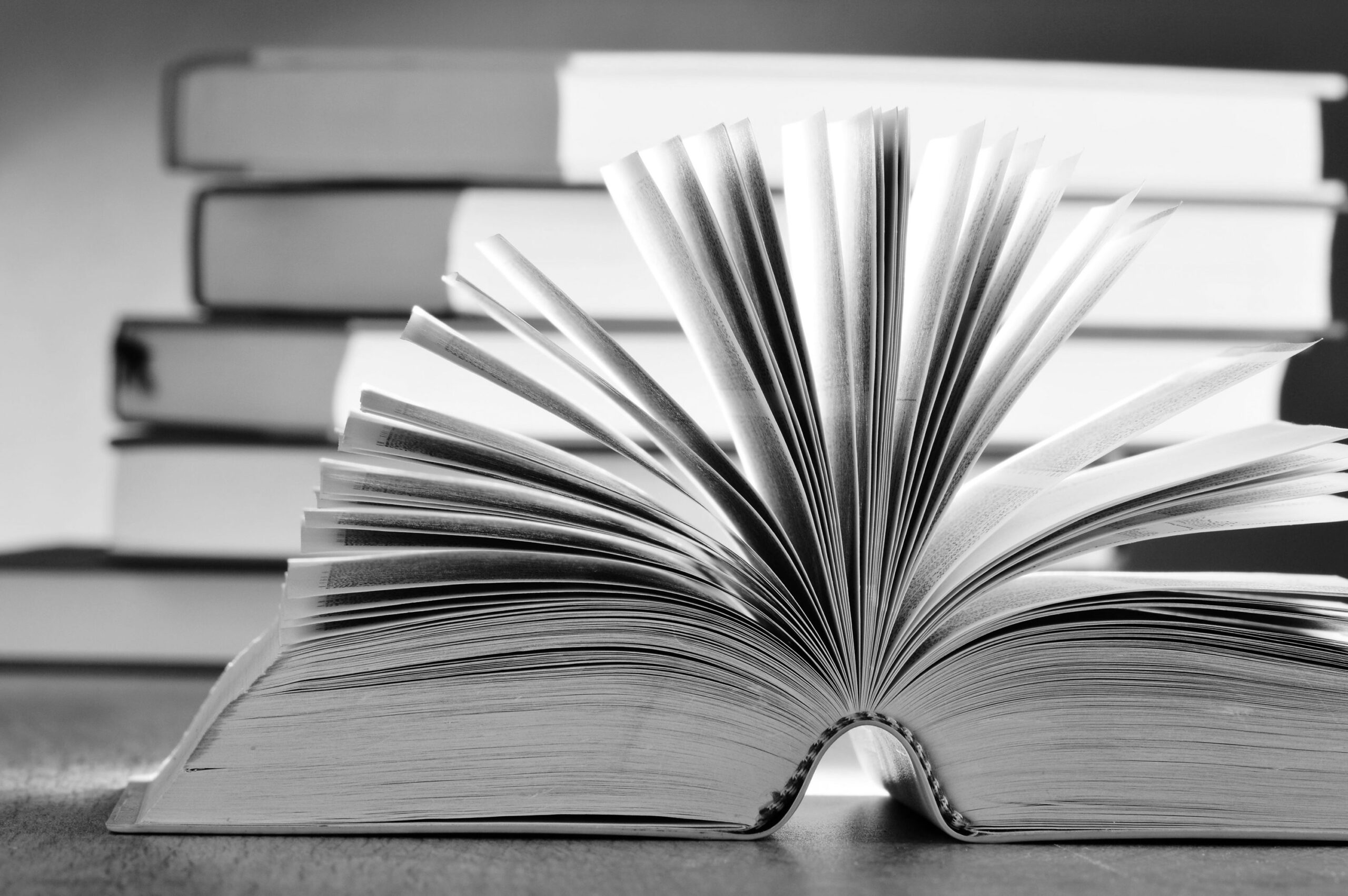
Fokus Gewalt
- Drohungen
Gemäss Strafgesetzbuch Art 180 kann eine Drohung auf Antrag den Strafverfolgungsbehörden gemeldet werden, wenn die bedrohte Person durch die Androhung eines schweren Nachteils in Schrecken oder Angst versetzt, wird. Ob die drohende Person die Drohung ernst meint oder nicht, ist für die Strafbarkeit nicht von Belang.
Wenn Drohungen im Kontext von häuslicher Gewalt stattfinden, wird der Täter oder die Täterin von Amtes wegen verfolgt, wenn er/sie: a) der Ehegatte des Opfers ist und die Drohung während der Ehe oder bis zu einem Jahr nach der Scheidung begangen wurde, abis) die eingetragene Partnerin oder der eingetragene Partner des Opfers ist und die Drohung während der eingetragenen Partnerschaft oder bis zu einem Jahr nach deren Auflösung begangen wurde; oder b) der hetero- oder homosexuelle Lebenspartner des Opfers ist, sofern sie auf unbestimmte Zeit einen gemeinsamen Haushalt führen und die Drohung während dieser Zeit oder bis zu einem Jahr nach der Trennung begangen wurde.
Ob Drohungen in Bild, Schrift, mittels der digitalen Medien oder auch mit Gesten (z.B. Schüsse in die Luft) gemacht werden, spielt für die Strafbarkeit keine Rolle. Bei der rechtlichen Würdigung wird zudem immer auch der Gesamtkontext berücksichtigt.
Bedrohte Menschen sollten den Gang zur Polizei nicht scheuen, wenn sie die Drohung ernst nehmen, Angst bekommen und das angedrohte Übel schwer wiegt. Der ultimative Nachteil wird durch Todesdrohungen angekündigt und diese sollten – werden sie ernst genommen -auch in jedem Fall angezeigt werden.
Eine perfide Form von Drohen stellen anonyme Drohungen dar. Die betroffenen Personen können die Ernsthaftigkeit nicht einordnen, da sie den Absender nicht kennen, was zusätzliche Ängste auslösen kann. Das Kommunikationsverhalten über die digitalen Medien zeichnet sich unter anderem auch dadurch aus, dass die Hemmschwellen für asoziales Verhalten durch die Distanz und die vermeintliche Anonymität tiefer liegen als bei der Face-to-Face-Kommunikation. Drohungen sind auch in digitalen Medien strafbar und diese feige Form des Drohens sollte angezeigt werden, denn die Strafverfolgungsbehörden können unter Umständen die Absender ausfindig machen und den Drohenden einen Schuss vor den Bug verpassen.
Zum einen ermittelt sie in einfachen Fällen von Drohungen und zum anderen muss die Strafverfolgung immer auch entscheiden, ob die Drohungen echte Warnungen für das angedrohte Übel darstellen. In einigen Polizeikorps resp. in einigen Kantonen wurde bereits ein so genanntes (kantonales) Bedrohungsmanagement eingeführt. Ein Bedrohungsmanagement dient der Erkennung, Einschätzung und Entschärfung von Bedrohungslagen und Gefährdungssituationen. Bei Drohungen muss also eingeschätzt werden, ob es sich um Warnzeichen für weitere Gewalthandlungen oder um leere Drohungen handelt.
- Häusliche Gewalt
Wenn keine akute Gewaltsituation vorhanden ist, Sie jedoch in einer Beziehung leben, in der Sie sich in Ihren Freiheiten eingeschränkt fühlen, wenn Sie sich Ihrem Partner oder Ihrer Partnerin nicht gewachsen fühlen oder Konflikte vorherrschen, reden Sie darüber! Kontaktieren Sie eine Vertrauensperson oder eine Beratungsstelle. Brechen Sie Ihr Schweigen, Sie haben ein Recht auf eine gewaltfreie Beziehung! Im Gegenteil, brechen Sie Ihr Schweigen! In allen Kantonen gibt es Paar- oder Eheberatungsstellen, die Sie einfach im Internet finden.
In jedem Kanton können sich Betroffene an die Opferhilfe wenden. Gewaltopfern jeden Alters und Geschlechts wird hier kostenlos Hilfe angeboten. Die Unterstützung reicht von der Organisation medizinischer Versorgung über juristische Beratung und therapeutische Unterstützung bis hin zu materieller Hilfe. Die Beratungen werden vertraulich geführt und können anonym in Anspruch genommen werden. Auch Nahestehende und Angehörige werden beraten und unterstützt. Dabei ist es nicht erforderlich, dass ein Strafverfahren durchgeführt wird. Mitarbeitende der Opferhilfe unterliegen der Schweigepflicht. Nur wenn die körperliche, psychische oder sexuelle Integrität einer minderjährigen oder unmündigen Person gefährdet ist, kann die Opferhilfe die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) informieren bzw. Anzeige erstatten.
Für Frauen und deren Kinder in akuten Gewaltsituationen bieten Frauenhäuser sofortigen Schutz, Unterkunft und Beratung. Auch wenn gemäss den gesetzlichen Bestimmungen gewaltausübende Personen weggewiesen werden und die Opfer so in der gewohnten Umgebung bleiben können, gibt es weiterhin Fälle, in denen Frauen nur in Frauenhäusern die nötige Sicherheit finden. Gerade Frauen, die über kein ausreichendes soziales Netz verfügen oder bei denen die Bedrohungslage diffus ist, bieten Frauenhäuser befristeten Schutz. In den Frauenhäusern sollen die Opfer zur Ruhe kommen, Sicherheit gewinnen und Anschlusslösungen finden.
In einzelnen Kantonen stehen Schutzunterkünfte für gewaltbetroffene Männer zur Verfügung.
Bestehende Beratungsangebote für Männer finden Sie unter www.maenner.ch und Männerhäuser unter zwueschehalt.ch und pharos-geneve.ch.
Auch gewalttätige Menschen leiden oft an den Folgen ihrer Handlungen, die sie oft im Vorfeld nicht steuern konnten. Sie müssen jedoch die Verantwortung für ihr Handeln übernehmen und an ihrem gewalttätigen Verhalten arbeiten.
Der Schweizerische Dachverband für Gewaltprävention solvio stellt die Adressen bezüglich Hilfe für Gewaltausübende (Beratungsstellen gegen Gewalt und Lernprogramme) zur Verfügung (nach Region geordnet).
Physische Gewalt ist die offensichtlichste Gewaltform und reicht von tätlichen Angriffen bis hin zu Tötungsdelikten.
Sexuelle Gewalt umfasst unter anderem sexuelle Belästigung oder Nötigung bis hin zur Vergewaltigung.
Für die Strafverfolgungsbehörden sind die psychischen Gewaltformen weniger offensichtlich, auch wenn diese für Betroffene nicht weniger Leid verursachen. Zur psychischen Gewalt zählen unter anderem Beleidigungen, Einschüchterungen, Erniedrigungen oder eifersüchtiges Verhalten. Die meisten dieser Formen können rechtlich geahndet und somit zur Anzeige gebracht werden, wie z. B. Drohung, Nötigung, Freiheitsberaubung und die Nachstellung nach einer Trennung (Stalking).
Eine weitere Form von häuslicher Gewalt ist die finanzielle Gewalt. Diese umfasst Arbeitsverbot oder Zwang zur Arbeit, Beschlagnahmung des Lohnes oder auch die alleinige Verfügungsmacht über die finanziellen Ressourcen durch den Partner bzw. die Partnerin. Damit macht der Täter oder die Täterin das Opfer von sich abhängig.
Neben diesen vier Formen umfasst häusliche Gewalt auch Verhaltensweisen, die in ihrer Gesamtheit darauf abzielen, das Opfer zu kontrollieren und seinen freien Willen einzuschränken oder zu unterdrücken.
Häusliche Gewalt findet am häufigsten in erwachsenen Beziehungen (mit Kindern), unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung, statt. Es gibt jedoch noch eine Reihe von anderen Beziehungskonstellationen, die – wenn sie von Gewalt geprägt sind – ebenfalls unter den Begriff häusliche Gewalt fallen. Dazu zählen: Gewalt in Paarbeziehungen Jugendlicher, Zwangsheirat und Gewalt zwischen Zwangsverheirateten, sogenannte Ehrenmorde, Genitalverstümmelungen, Gewalt gegen Seniorinnen und Senioren im Familienverband, Gewalt von Eltern gegenüber Kindern und umgekehrt, Gewalt unter Geschwistern oder auch Stalking.
Auch hier können Ihnen die kantonalen Beratungsstellen der Opferhilfe weiterhelfen oder Sie an spezifische Hilfs- und Unterstützungsangebote weiterverweisen.
Gemäss Strafgesetzbuch (StGB) sind einfache Körperverletzung (Art. 123 Ziff. 2 Abs. 3-5 StGB), wiederholte Tätlichkeiten (Art. 126 Abs. 2 Bst. b, bbis und c StGB), Drohung (Art. 180 Abs. 2 StGB) sowie sexueller Übergriff und sexuelle Nötigung (Art. 189 StGB) und Vergewaltigung (Art. 190 StGB) in Ehe und Partnerschaft Offizialdelikte sind. Damit müssen diese Delikte von Amtes wegen verfolgt werden. Verfolgt werden sowohl Gewalthandlungen zwischen Ehepartnern als auch zwischen heterosexuellen oder gleichgeschlechtlichen Lebenspartner/-innen mit einem gemeinsamen Haushalt auf unbestimmte Zeit oder bis zu einem Jahr nach deren Trennung. Die zwischen Ehegatten begangenen Gewalthandlungen werden von Amtes wegen verfolgt, auch wenn diese je einen eigenen Wohnsitz haben oder getrennt leben oder bis zu einem Jahr nach der Scheidung.
Wurde Gewalt ausgeübt oder in massiver Weise angedroht und werden die Beteiligten weiterhin von der gewaltausübenden Person bedroht, prüft die Polizei eine Wegweisung und das Rückkehrverbot für die gewaltausübende Person. So soll gewährleistet werden, dass die Opfer, oft Frauen und Kinder, in ihrer Wohnung bleiben können.
Die von der Polizei angeordnete Wegweisung aus der Wohnung ist zeitlich beschränkt, je nach Kanton auf 10 bis 20 Tage. Für eine weitere Fernhaltung des Täters/der Täterin vom Opfer sind die Zivilgerichte oder andere Gerichtsbehörden zuständig. Diese können unter anderem Folgendes anordnen: Zuweisung der ehelichen Wohnung an das Opfer und seine Kinder zur alleinigen Benutzung während der Trennung, Verbot von Kontakten (persönlich, per Telefon, SMS, E-Mail, Brief) und ein Annäherungsverbot (Strasse, Quartier, Schule usw.).
Wird ein Kontaktverbot verhängt, ist es der gefährdenden Person verboten, mit der gefährdeten Person in irgendeiner Form Kontakt aufzunehmen. Dazu gehören das direkte Ansprechen, Telefonanrufe, SMS, E-Mails, Briefe, Facebook etc. Das Kontaktverbot kann auch auf weitere Personen ausgedehnt werden (z. B. Kinder und nahestehende Personen), wenn es der Schutz erfordert.
Im Falle akuter Gewalt- oder Bedrohungslagen gibt es rund um die Uhr den Polizeinotruf (Tel. 117). Akut bedeutet nicht, dass man bis zum letzten Moment zuwarten muss! Wer sich bedroht fühlt, sollte lieber einmal zu früh als einmal zu spät anrufen.
Bei ihrer Arbeit stellt die Polizei den Opferschutz an erste Stelle und kümmert sich dann darum, die Täterschaft zur Verantwortung zu ziehen. Idealerweise verläuft eine polizeiliche Intervention folgendermassen: Die Polizei lässt sich von den Opfern an Ort und Stelle über den Vorfall informieren. Sie befragt das Opfer getrennt von der tatverdächtigten Person und klärt ab, ob Dinge passiert sind, die gegen das Strafrecht verstossen. Bei erkennbaren Körperverletzungen begleitet sie das Opfer zur medizinischen Behandlung. Die Polizei informiert die Betroffenen über die möglichen rechtlichen Schritte. Dabei werden die Betroffenen von Personen des gleichen Geschlechts befragt. Zudem wird darauf geachtet, dass Kinder altersgerecht behandelt und informiert werden; je nach Sachlage wird die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) informiert. Wurde Gewalt ausgeübt oder in massiver Weise angedroht und werden die Beteiligten weiterhin von der gewaltausübenden Person bedroht, prüft die Polizei eine Wegweisung und das Rückkehrverbot für die gewaltausübende Person. So soll gewährleistet werden, dass die Opfer, oft Frauen und Kinder, in ihrer Wohnung bleiben können.
Rufen Sie bei akuten Notsituationen die Polizei: Notruf 117. Gefährden Sie sich nicht selber, indem Sie sich einmischen.
Erklären Sie den betroffenen Personen, dass Gewalt im häuslichen Bereich kein privates Problem ist. Weisen Sie sie darauf hin, dass es in der Schweiz Gesetze gibt, die Opfer schützen, und Beratungsstellen, die Hilfe und Unterstützung anbieten.
Bieten Sie allenfalls persönliche Hilfe an (Zuhören, Zuflucht in Notsituationen). Haben Sie aber auch Geduld, wenn Ihre Hilfsangebote vorerst noch abgelehnt werden.
Sammeln Sie Informationen über professionelle Hilfsangebote für Opfer oder Täter bzw. Täterinnen und geben Sie diese an die betroffene Person weiter.
Bei Fragen nach dem Ausmass muss unterschieden werden zwischen dem, was tatsächlich passiert, und dem, was die Behörden (Polizei, Opferhilfestellen usw.) darüber wissen.
Tatsache ist, dass die Polizei mehrere tausend Male im Jahr wegen Konflikten und Gewalthandlungen im familiären und partnerschaftlichen Kontext zum Einsatz kommt. Sobald die Strafverfolgungsbehörde aufgrund eines polizeilichen Einsatzes von einer potenziellen Straftat erfährt, wird eine Untersuchung eingeleitet, ohne dass dazu eine formelle Anzeige des Opfers notwendig ist. Schätzungen gehen davon aus, dass lediglich 20 Prozent der Fälle von häuslicher Gewalt der Behörde zur Kenntnis gebracht werden. Somit wäre das tatsächliche Ausmass fünf Mal grösser als die registrierten Fälle. Besonders schwere Fälle werden aber meistens polizeilich bekannt.
In der Schweiz sind jährlich zwischen 20 und 30 Todesopfer als Folge häuslicher Gewalt zu beklagen; das heisst, dass 40 bis 50 Prozent aller Tötungsdelikte in der Schweiz auf den häuslichen Bereich entfallen. Hinzu kommen zwischen 40 und 60 versuchte Tötungen im Kontext häuslicher Gewalt.
Die Anzeigen zu Delikten im Kontext häuslicher Gewalt werden jährlich durch das Bundesamt für Statistik publiziert.
Kinder, die Gewalt in der elterlichen Paarbeziehung oder zwischen Angehörigen oder nahen Bezugspersonen miterleben, sind immer Opfer von psychischer Gewalt. Zudem ist bekannt, dass diese Kinder auch überdurchschnittlich häufig physisch oder psychisch misshandelt, missbraucht oder vernachlässigt werden. Kinder, die in einem von Gewalt geprägten Familiensystem aufwachsen, können Schädigungen davontragen und müssen besonders geschützt werden. Hinzu kommt, dass zu Hause erlebte Gewalt für die weitere Entwicklung der betroffenen Kinder ein Risikofaktor ist, im späteren Leben selbst Opfer oder Täter bzw. Täterin zu werden.
Nach polizeilichen Einsätzen, in die Kinder und Jugendliche involviert sind, informiert die Polizei die Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB). Diese Behörde ist für die Abklärung der Situation und allfällige Massnahmen zum Schutz der Kinder zuständig.
Werden die Angebote der Opferhilfe in Anspruch genommen, erhalten auch die Minderjährigen spezifische Unterstützung und Beratung. Wenn die körperliche, psychische oder sexuelle Integrität einer minderjährigen oder unmündigen Person gefährdet ist, kann die Opferhilfe die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) informieren bzw. Anzeige erstatten.
Migrantinnen und Migranten leben vielfach unter Bedingungen, die für jeden Menschen das Risiko erhöhen würden, Opfer von häuslicher Gewalt zu werden: Migrantinnen sind oft jung verheiratet und zumeist finanziell weniger gut gestellt, die Familie lebt häufig in ungünstigen Wohnverhältnissen, die berufliche Situation dieser Menschen ist nicht selten unsicher und sie sind sozial weniger gut eingebettet. Zudem mussten viele Migrantinnen und Migranten beispielsweise bei der Flucht aus ihrem Land bereits Gewalt erleben oder wurden ungewollt Zeuginnen und Zeugen solcher Taten.
Die Trennung einer noch jungen Ehe kann dazu führen, dass eine Person, die aufenthaltsrechtlich an ihren Partner oder ihre Partnerin gebunden ist, die Schweiz verlassen muss. Jedoch sieht die Änderung des Bundesgesetzes über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (AIG) von 2025 vor, dass Opfer häuslicher Gewalt (Ehegatten und Kinder) nach einer Auflösung der Ehe- oder Familiengemeinschaft unter bestimmten Bedingungen besseren Schutz erhalten (Art. 50 AIG).
Frühe Verheiratung, finanzielle Probleme, ungünstige Wohnsituationen, Arbeitslosigkeit und tiefer sozialer Status sind Faktoren, die nicht nur das Risiko Opfer, sondern selbst Täter häuslicher Gewalt zu werden, erhöhen. Opfer und Tatausübende mit Migrationshintergrund nehmen zudem die Unterstützungsangebote seltener wahr und können weniger auf ein stützendes soziales Umfeld zählen.
- Jugendgewalt
Gewalt von jungen Menschen kann ganz unterschiedliche Formen umfassen: Psychische und verbale Gewalt (z.B. Mobbing), körperliche und sexuelle Gewalt (z.B. Schlägereien, sexuelle Belästigung) bis hin zu Überfällen oder gar Mord oder Totschlag. Gewaltakte können sich gegen Menschen, Tiere oder Gegenstände (z.B. Vandalismus) richten. Wenn von Jugendgewalt im Allgemeinen die Sprache ist, wird meist kein Unterschied gemacht zwischen Gewalttaten, die von jungen Erwachsenen (18 bis 25 Jahre) oder von Minderjährigen (bis 17 Jahre) begangen werden. Die Justiz antwortet aber anders auf Straftaten von Minderjährigen, da das Jugendstrafrecht auf Resozialisierung ausgerichtet ist und nicht in erster Linie auf Bestrafung.
Für Jugendliche zwischen 10 und 18 Jahren gilt in der Schweiz das Jugendstrafrecht. Das Jugendstrafrecht setzt sich aus dem Jugendstrafgesetz (JStG) und der Jugendstrafprozessordnung (JStPO) zusammen. Bereits ab 10 Jahren sind Kinder also strafmündig und können aus strafrechtlicher Sicht in die Verantwortung gezogen werden. Strafmündigkeit bezeichnet grundsätzlich das Alter, ab welchem eine Person für eine Straftat bestraft werden kann. Massnahmen infolge Grenzüberschreitungen von unter 10-Jährigen werden von der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) veranlasst, insofern die Eltern nicht in der Lage sind, entsprechende Massnahmen vorzunehmen.
Im schweizerischen Jugendstrafrecht geht es in erster Linie um den Schutz und die Nacherziehung der Jugendlichen sowie die Verhinderung von weiteren Straftaten während der Jugend oder im späteren Erwachsenenalter. Für eine erfolgreiche Resozialisierung sind zeitnahe und angemessene Strafen und Massnahmen zentral. Aus diesem Grund werden in einem Strafverfahren auch immer vertiefte Abklärungen zu den persönlichen, familiären, schulischen, beruflichen und freizeitlichen Verhältnissen eines Jugendlichen durchgeführt. Unabhängig davon, ob eine erzieherische oder therapeutische Massnahme (z.B. ambulante Massnahme oder Heimunterbringung) oder eine Bestrafung (z.B. Freiheitsentzug, Busse, Verweis) angeordnet wird, soll diese auf den Täter oder die Täterin massgeschneidert sein, erzieherisch und präventiv wirken, damit weitere Straftaten möglicherweise verhindert werden können.
Bezüglich der Strafbarkeit von Delikten gibt es keinen Unterschied im Jugend- und Erwachsenenstrafrecht. Das heisst, was für Erwachsene verboten ist, ist auch für Jugendliche verboten.Verschiedene Polizeikorps in der Schweiz haben Jugenddienste gegründet, die sich mit der Aufklärung jugendspezifischer Straftaten sowie der Intervention und Prävention im Zusammenhang mit Jugendlichen befassen. Eine Übersicht über sämtliche polizeilichen Jugenddienste finden Sie hier.
Sozialpolitische Massnahmen können auch gewaltpräventiv wirken, wenn zum Beispiel die sozialen Kompetenzen von Jugendlichen dadurch gestärkt werden. Dies kann in der direkten Arbeit mit Jugendlichen oder indirekt über bestimmte Settings wie (z. B. Jugendgruppe, Familie und Schule) erfolgen. Gleichzeitig können Massnahmen zur Verbesserung von strukturellen Rahmenbedingungen – Wohnumfeld und Quartier, Förderung des Berufseinstiegs und der Integration – einen wichtigen Beitrag zur Gewaltprävention leisten. So gesehen wirkt gezielte und effektive Integrations- oder Bildungspolitik immer auch kriminalpräventiv.
Früherkennung und Frühintervention sind zentral bei der Gewaltprävention von Jugendlichen. Konzepte zur Früherkennung und Frühintervention wurden anfänglich für die Suchtprävention entwickelt. Sie finden mittlerweile auch in anderen Präventionsbereichen – insbesondere der Gewaltprävention – Anwendung. Ein wichtiger Grundsatz ist dabei, dass Interventionen nicht nur auf die Reduktion der Risiken sondern auch auf die Stärkung des Individuums und der vorhandenen Ressourcen zielen sollten.
Während der gesamten Entwicklung des Kindes übernimmt die Familie eine zentrale Rolle auch für die Gewaltprävention. Dafür gibt es zwei Gründe: Zum einen sind familiäre Risikofaktoren für die Entstehung von Verhaltensproblemen in Kindheit und Jugend mitverantwortlich. Zum anderen ist die elterliche Fürsorge für eine gelungene emotionale und soziale Entwicklung des Kindes unabdingbar.
- Eine familienbasierte Prävention möchte den Eltern helfen, ihr Kind über alle Lebensphasen hinweg in seiner sprachlichen, sozialen, körperlichen, kognitiven, emotionalen, moralischen und musischen Entwicklung zu unterstützen. Andererseits sollen dysfunktionale sowie Aggression und Konflikt verstärkende Erziehungspraktiken damit vermieden werden. Massnahmen der familienbasierten Prävention werden in der Schweiz sowohl von öffentlichen wie auch von privaten Akteuren realisiert.
- Schliesslich kommen bei festgestellten Problemen auch behördlich verordnete Massnahmen zum Einsatz, wie z.B. obligatorische Elternkurse, verordnete Familienbegleitungen (sozialpädagogische Familienbegleitung, kompetenzorientierte Familienarbeit etc.) oder auch Fremdplatzierungen in Pflegefamilien. Solche Massnahmen werden in aller Regel von den Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (KESB) ausgesprochen.
- Gewaltprävention in der Familie richtet sich aber nicht nur an Eltern, Grosseltern oder andere Betreuungspersonen, sondern ebenso an Kinder und Jugendliche selbst. In diesem Zusammenhang sind beispielsweise Massnahmen gegen Gewalt in jugendlichen Liebesbeziehungen oder auch Gewalt von Jugendlichen gegenüber Eltern, Geschwistern und Grosseltern zu erwähnen.
Kinder verbringen viel Zeit in der Schule. Ihre Lebensqualität und ihr Verhalten werden somit stark von den Beziehungen zu den Mitschülerinnen und Mitschülern sowie zu den Lehrpersonen beeinflusst. Die Schule spielt also eine wichtige Rolle für die soziale Entwicklung der Schülerinnen und Schüler. Sie ist aber auch ein Ort, an dem es zu verschiedenen Formen von Gewalt kommt. Deshalb ist es die Pflicht von Schulen, sich mit der Gewaltprävention zu befassen. Um präventiv gegen Gewalt an Schulen vorzugehen, sollten die folgenden Punkte beachtet werden:
- Die Förderung eines positiven Umfelds für alle Akteure der Schule ist die Grundlage für die erfolgreiche Umsetzung von Präventionsmassnahmen. Es bestehen vielseitige Möglichkeiten, damit die Schule ein harmonisches Zusammenleben gestalten kann: Verbesserung des Schulklimas, klare Regeln und Sanktionen, Erarbeitung einer Charta oder partizipative Strukturen.
- Die frühe und gezielte Einwirkung gegen problematisches Verhalten wie Schulmobbing oder Schwänzen sollte ebenfalls zu den Massnahmen einer umfassenden Präventionsstrategie an Schulen gehören.
- Die Schulung der Lehrkräfte ist ein bedeutendes Element der Gewaltprävention. Dazu gehören auch aktuelle Kenntnisse über neue Formen von Gewalt wie Cybermobbing sowie die Sensibilisierung für Prozesse der Frühintervention.
- Die Zusammenarbeit mit den Eltern ist wesentlich. Als Hauptverantwortliche für die Erziehung ihrer Kinder sollen und müssen die Eltern in jedes Präventions- oder Interventionsvorhaben einbezogen werden.
- Mit einem Interventionskonzept für Krisensituationen kann beim Auftreten von schwerwiegenden Ereignissen effizient und zielführend mit den richtigen Partnern und Ressourcen reagiert werden. Ein von der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) erstellter Leitfaden steht als Konzeptgrundlage zur Verfügung.
Während für Kleinkinder vor allem die Familie und für jüngere Kinder später die Schule zentrale Lern- und Lebensorte sind, erweitert sich der Aktionsradius im Jugendalter schrittweise auf die Nachbarschaft und den öffentlichen Raum. Damit verbunden ändern sich sowohl Schutz- wie Risikofaktoren für jugendliches Gewaltverhalten. Der Alkohol- und Drogenkonsum, unstrukturierte Freizeitaktivitäten, häufiger abendlicher Ausgang, geringe soziale Kontrolle, ein delinquenter Freundeskreis sowie problembehaftete Quartiere können wichtige Einflussfaktoren für ein Gewaltverhalten sein.
Von grosser Bedeutung für die Gewaltprävention sind die Gestaltung und Verfügbarkeit von öffentlichen Räumen, von Freizeitangeboten sowie der Zugang von Jugendlichen in Problemsituationen zu Fachleuten. Erfolgreiche Strategien zur Vorbeugung von Jugendgewalt kombinieren präventive Massnahmen mit angemessenen Interventions- und Ordnungsmassnahmen. In der Schweiz besteht bereits eine Vielzahl von erfolgreichen Massnahmen wie z.B. Förderung der Quartierentwicklung, organisierte und leicht zugängliche Freizeitaktivitäten, Gewaltprävention in Vereinen oder bei Sportveranstaltungen oder Konfliktprävention und -intervention im öffentlichen Raum durch mobile Jugendarbeit oder die Jugendpolizei.
- Menschenhandel
In dieser Hinsicht stellt die Schweiz in Europa keine Ausnahme dar. In allen Regionen der Schweiz haben die Strafverfolgungsbehörden bereits Fälle von Menschenhandel aufgedeckt.
Menschenhandel findet im Verborgenen statt und ist dadurch für viele Menschen nicht sichtbar. Menschenhändler, also zum Beispiel Bordellbetreiber und Zuhälter von Zwangsprostituierten, betreiben einen grossen Aufwand, um Ausbeutungssituationen so zu tarnen, als würden die Opfer freiwillig arbeiten. Sie drohen ihnen und erpressen sie, damit sie ihren Freiern nichts über ihre Situation zu erzählen. Viele Opfer von sexueller Ausbeutung leben ausserdem sehr isoliert und haben abgesehen von Freiern keinerlei Kontakt zur Aussenwelt. Das gleiche gilt für Hausangestellte, deren Arbeitskraft ausgebeutet wird. Sie treten gar nie in der Öffentlichkeit in Erscheinung, weil sie in vielen Fällen das Haus gar nicht verlassen dürfen.
Wenn es in einer Stadt oder einem Kanton keine entdeckten Fälle von Menschenhandel gibt, bedeutet das nicht, dass keine Menschenhändler in diesem Gebiet tätig sind. Für das Erkennen von Menschenhandel und die Identifizierung der Opfer sind oft besondere Kenntnisse über diese Kriminalitätsform notwendig. Nur ausgebildete Spezialistinnen und Spezialisten verfügen in der Regel über das notwendige Wissen, um bei Kontrollen am Arbeitsplatz Anhaltspunkte für die Ausbeutung von Menschen zu erkennen. Trotzdem kommt immer wieder vor, dass Nicht-Spezialisten auf ausgebeutete Menschen aufmerksam werden.
Klären Sie Ihr Umfeld über Menschenhandel und Menschenschmuggel auf und zeigen Sie Ihren Verwandten und Bekannten, wo sie sich über Menschenhandel und Menschenschmuggel informieren können. Sensibilisieren Sie sie für die Opfer und erklären Sie ihnen, wie sie im Verdachtsfall vorgehen sollen.
Ja. Die meisten ausgebeuteten Opfer erhalten regelmässig einen bescheidenen Geldbetrag für ihre Arbeit und scheinen aus diesem Grund der Tätigkeit und der Situation, in der sie sich befinden, zuzustimmen. Trotzdem kann laut Bundesgericht Menschenhandel vorliegen, sofern die Opfer verletzlich sind und diese Verletzlichkeit durch die Täter ausgenutzt wird. Eine solche Verletzlichkeit kann gegeben sein, wenn das Opfer im Heimatland schwierigen wirtschaftlichen oder sozialen Verhältnissen ausgesetzt ist. Wenn also der Täter von der offensichtlichen Bedürftigkeit des Opfers im Heimatland profitiert, indem er ihm einen bescheidenen Verdienst zugesteht, um es dadurch gefügig zu machen, so liegt Ausbeutung vor, unabhängig von einer allfälligen Zustimmung des Opfers.
Das Prostitutionsmilieu ist attraktiv für Personen, die vom Menschenhandel profitieren wollen, da der angestrebte Profit beträchtlich sein kann, und das Risiko einer Verurteilung eher gering ist.
Falls es Grund zur Annahme gibt, dass das Leben eines Opfers von Menschenhändlern akut bedroht ist, muss die Polizei (Telefonnummer 117) so schnell wie möglich verständigt werden.
In allen anderen Fällen existieren in der Schweiz mehrere spezialisierte Hilfsorganisationen, die sich um Opfer von Menschenhändler kümmern. Zu erwähnen sind beispielsweise die Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration (FIZ) mit Sitz in Zürich oder den Verein «Xenia» – Beratungsstelle für Frauen im Sexgewerbe in Bern. Betroffene und Angehörige von Betroffenen können sich auch bei einer Kantonalen Opferberatungsstelle melden.Menschenhandel ist ein lukratives Geschäft, weil hohe Gewinne realisiert werden können. Es gibt viele Kriminelle, die daran interessiert sind, mit Menschenhandel reich zu werden. Nebst den hohen Gewinnen, die mit Menschenhandel zu erwirtschaften sind, ist das Risiko einer Verurteilung gering, weil für die Strafverfolgung und die Opferbetreuung nur beschränkte Ressourcen zur Verfügung stehen und die Beweisführung vor urteilenden Gerichten oft nicht standhält. Wenn es zu einer Verurteilung kommt, fallen die Strafen in der Schweiz im Vergleich zu denen im Ausland gering aus.
Ausserdem ist die Polizei auf die Zusammenarbeit mit den Opfern und Zeugen angewiesen, um gegen die Menschenhändler effizient ermitteln zu können und sie für ihre Taten verantwortlich zu machen. Manche Opfer sind jedoch so traumatisiert, dass sie nicht in der Lage sind, einen Gerichtsprozess durchzustehen oder sie fürchten, dass die Täter sich an ihnen oder ihren Angehörigen rächen werden.
In unserer globalisierten Welt ist es heute viel leichter, zu erfahren, wie die Lebensbedingungen in einem anderen Land oder Kontinent sind. Gleichzeitig sind wir heute viel mobiler als früher: Es gibt Flugverbindungen in alle Länder der Welt und Reisen ist günstiger. Dies hat zur Folge, dass immer mehr Menschen ihre Heimat verlassen und ihr Glück anderswo suchen. Sie wollen der Armut und der Arbeits- oder Perspektivenlosigkeit in ihrem Land entfliehen und werden von Ländern angezogen, wo die Nachfrage nach billigen und ungelernten Arbeitskräften gross zu sein scheint.
Weil viele westeuropäische Nationen ihre Asyl- und Flüchtlingspolitik verschärft haben und es nicht mehr leicht ist, legal in solche Länder zu migrieren, lassen sich gewisse Menschen auf scheinbar seriöse und andere auf offensichtlich dubiose Vermittler und Vermittlungsagenturen ein, um legal oder illegal nach Westeuropa zu gelangen. Viele dieser Menschen gelangen zwar zu uns, aber werden hier ausgebeutet.
Laut Bundesgesetz über die Hilfe für Opfer von Straftaten (Opferhilfegesetz) stehen Beratung und Hilfe jeder Person zu, die in der Schweiz durch eine Straftat in ihrer körperlichen, sexuellen oder psychischen Integrität unmittelbar beeinträchtigt wurde – unabhängig von ihrer Nationalität und ihrem Aufenthaltsstatus. Opfer von Menschenhandel haben in der Regel psychische und physische Gewalt erlitten und damit Anspruch auf Beratung und Hilfe. Die Hilfeleistungen beinhalten ein auf die Situation des Opfers bezogenes Bündel an Massnahmen. Dazu zählt unter anderem Unterkunft, Begleitung und Betreuung während der Stabilisierung sowie medizinische und rechtliche Hilfe. Weil es sich bei den Opfern von Menschenhandel oft um traumatisierte Personen handelt, ist meist eine Betreuung durch spezialisierte Opferbetreuungsstellen notwendig.
Da sich viele Opfer illegal in der Schweiz aufhalten, wird ihnen vor der Ausschaffung eine Bedenkzeit von mindestens 30 Tagen eingeräumt, um sich zu regenerieren und zu entscheiden, ob sie Strafanzeige gegen die Menschenhändler erstatten will. Nach Ablauf der Bedenkzeit kann dem Opfer für die Dauer des Ermittlungs- und Gerichtsverfahren eine Aufenthaltsbewilligung erteilt werden. Sind Gründe vorhanden, die gegen eine Rückkehr ins Heimatland sprechen, kann dem Opfer eine Aufenthaltsbewilligung aufgrund eines schwerwiegenden persönlichen Härtefalles erteilt werden. Ausserdem bietet die Schweiz den Betroffenen Rückkehrhilfe an.
Die Fachstelle für Frauenhandel und Frauenmigration (FIZ) hat folgende Empfehlungen für verantwortliche Freier abgegeben:
- Nutzen Sie Ihr Handy! Geben Sie der Frau die Möglichkeit zu telefonieren – mit einer Beratungsstelle.
- Rufen Sie die Fachstelle für Frauenhandel und Frauenmigration (FIZ) unter der Telefonnummer 044 436 90 00 an. Die Beraterinnen dieser Fachstelle werden versuchen, Kontakt zu der Frau aufzunehmen, und sprechen mit ihr, wenn möglich in ihrer Muttersprache. Vorausgesetzt sie will das.
- Geben Sie der Frau die Telefonnummer von FIZ (044 436 90 00) und die Adresse der Webseite. Die Texte der Webseite sind in mehreren Sprachen (u.a. Ungarisch, Rumänisch und Thai) verfasst.
- Stalking
Jegliche Arten von Täter/-in-Opfer-Konstellationen sind möglich. Am häufigsten wird eine Frau durch einen Mann gestalkt. Es werden jedoch auch Männer von Frauen gestalkt oder Frauen respektive Männer stalken ihre gleichgeschlechtlichen Mitmenschen. Man geht davon aus, dass es sich in mehr als 80 Prozent der Fälle um männliche Stalker handelt und mehr als 80% der Opfer weiblich sind.
Stalkende sind vorwiegend männlich und können aus allen gesellschaftlichen Schichten stammen. Sie agieren überwiegend als Einzeltäter, auch wenn sie das Umfeld ihres Opfers teilweise in ihre Stalking-Handlungen miteinbeziehen. Ihre Opfer stammen zumeist aus ihrem persönlichen oder beruflichen Umfeld. Stalking durch Unbekannte ist eher die Ausnahme. Am häufigsten werden ehemalige Intimpartner/-innen gestalkt. Aber auch Mitarbeitende, Bekannte, Nachbarn und Nachbarinnen, Fans sowie Kundinnen und Kunden können zu Stalkerinnen und Stalkern werden.
Neben einer allgemein schwindenden Lebensqualität leiden Opfer oftmals an verringertem Selbstvertrauen, Angstzuständen, Schlafstörungen, Kopf- und Magenschmerzen, Reizbarkeit, Depressionen, Alpträumen, verstärktem Misstrauen bis hin zu einem Verfolgungswahn allgemeiner Natur. Zudem fühlen sich die Opfer häufig hilflos und verzweifelt, da sie keinen Ausweg aus der Situation erkennen. Durch die ständigen Beobachtungen und Nachstellungen stellt selbst die eigene Wohnung keine sichere Umgebung mehr dar. Die Angehörigen werden oft nicht benachrichtigt, da das Opfer sie vor der Stalkerin oder dem Stalker schützen will. Soziale Isolation ist die Folge. Die Leistungsfähigkeit leidet durch die permanenten Strapazen und regelmässige Freizeitaktivitäten werden aufgegeben, da die Stalkerin/ der Stalker dort lauern könnte.
Stalking muss ernst genommen werden. Auch wenn das Stalking-Verhalten zu Beginn des Prozesses eher als unangenehmes Eindringen in die Privatsphäre denn als gefährliche Drohung wahrgenommen wird, können sich die anfangs wohlwollenden Motive der Stalkerin bzw. des Stalkers schnell verändern. Physische und sexuelle Gewalt sind bei Stalkerinnen und Stalkern verbreitete Mittel um ihre Ziele zu erreichen. Doch auch ohne Anwendung von Gewalt sind die Folgen für das Opfer erheblich: Angstzustände, Schlafstörungen, Kopf- und Magenschmerzen, Reizbarkeit, Depressionen und Alpträume sind nur einige Beispiele. Stalker/innen sind deswegen besonders gefährlich, da sie oft unter einer verzerrten Wahrnehmung leiden und somit die Ablehnung seitens ihrer Opfer falsch interpretieren oder gar nicht wahrnehmen.
Obwohl Stalking kein Massenphänomen darstellt, hat die Anzahl der Betroffenen in den letzten Jahrzehnten deutlich zugenommen. Dies kann teilweise auf unsere Gesellschaft zurückgeführt werden, welche grossen Wert auf das Individuum und dessen Bedürfnisse legt. Ausserdem trägt die steigende Anzahl an Scheidungen und wechselnden Beziehungspartnern zu dieser Entwicklung bei. Schliesslich kann die Zunahme an Stalking-Fällen den technischen Fortschritten zugeschrieben werden. Der erleichterte Zugang zu Kommunikationsmitteln wie Handys und Internet begünstigen effiziente Stalking-Handlungen und zudem sinkt die Hemmschwelle für belästigendes Verhalten durch die vermeintliche Anonymität und durch die Distanz der Online-Kommunikation.
In der Schweiz wurde Stalking bislang wenig erforscht, dadurch ist die Anzahl der Betroffenen schwer einzuschätzen. Eine Studie aus Mannheim aus dem Jahr 2018, bei der 2’000 Personen zu ihren Erfahrungen mit Stalking befragt wurden (mit 444 Rückmeldungen), zeigte auf, dass 10.8 % der Befragten im Laufe ihres Lebens mindestens einmal von Stalking betroffen waren. In 83.3 % der Fälle handelte es sich um Frauen. Bei 35.4 % dauerte das Stalking ein Jahr oder länger.
Vereinzelt treten in der Praxis auch vorgebliche Opfer auf, d.h. Personen, die fälschlicherweise behaupten, Opfer von Stalking zu sein (False victimization syndrom). Die Natur der Gründe ist unterschiedlich. Zumeist beruhen die Falschaussagen nicht auf Böswilligkeit, sondern auf Irrglauben und falscher Wahrnehmung. Die Identifizierung solcher Personen gestaltet sich schwierig. Auch wenn es dieses Falsche-Opfer-Syndrom selten gibt (ca. 10%), ist es wichtig, sich der Möglichkeit bewusst zu sein.
- Waffen
- Gemäss Waffengesetz gelten Imitations-, Schreckschuss- und Soft-Air-Waffen als Waffen, wenn die Gefahr einer Verwechslung mit einer Feuerwaffe besteht.
- Auch Druckluft- und CO2-Waffen werden nach dem Gesetz wie Waffen behandelt, insofern eine Verwechslungsgefahr besteht oder wenn die Mündungsenergie mindestens 7,5 Joule beträgt.
- Zudem sind spezielle Messer und sonstige gefährliche Gegenstände, die dazu bestimmt sind, Menschen zu verletzen sowie sämtliche Elektroschockgeräte und Sprayprodukte (ausgenommen Pfeffersprays) verbotene Waffen.
- Soft-Air-Waffen dürfen als Sportwaffen an Minderjährige ausgeliehen werden, wenn die minderjährige Person nachweisen kann, dass sie regelmässig Schiesssport betreibt, nicht angenommen werden kann, dass sie sich oder Dritte mit der Waffe gefährdet und sie nicht im Strafregister eingetragen ist.
- Eine Soft-Air-Waffe gilt dann als Sportwaffe, wenn das entsprechende Modell an nationalen oder internationalen Wettkämpfen zugelassen ist.
- Die gesetzliche Vertretung der minderjährigen Person oder der Verein müssen die Ausleihe dem kantonalen Waffenbüro innerhalb von 30 Tagen mit dem entsprechenden Formular melden.
Ja, es müssen jedoch Vorschriften beachtet werden. Die Identifikation des Verkäufers und ein sachgerechter Umgang müssen gewährleistet sein.
Nein, für den Kauf oder Verkauf von Imitations-, Schreckschuss- und Soft-Air-Waffen braucht es keine Erwerbsbewilligung.
Man darf die Waffe nur als Teilnehmer einer Schiessveranstaltung auf einem abgesicherten Gelände auf sich tragen.
Die Soft-Air-Waffe darf nur auf direktestem Weg zwischen dem eigenen Wohnsitz und dem Ort der Schiessveranstaltung transportiert werden.
Waffen, die ohne Berechtigung, beispielsweise von Minderjährigen oder im öffentlichen Raum, getragen werden, können von den zuständigen Behörden beschlagnahmt werden.
Wenn nachgewiesen werden kann, dass die Gefahr einer missbräuchlichen Verwendung besteht, insbesondere wenn mit der Waffe Personen bedroht oder verletzt wurden, kann die Waffe definitiv eingezogen werden.
- Wer privat solche Waffen in das schweizerische Staatsgebiet bringen will, benötigt eine Bewilligung. Gesuche um nicht gewerbsmässige Einfuhr von Waffen finden Sie bei fedpol.
- Für die private, definitive Ausfuhr wird eine Bewilligung nach Güterkontrollgesetz benötigt. Diese wird vom Staatssekretariat für Wirtschaft SECO erteilt.
- Wer gewerbsmässig solche Waffen in das schweizerische Staatsgebiet ein- oder ausführen will, benötigt ein Waffenhandelspatent für Nichtfeuerwaffen und eine entsprechende Bewilligung.
- Wer ohne Berechtigung Waffen anbietet, überträgt, vermittelt, erwirbt, besitzt, herstellt, gewerbsmässig repariert, abändert, trägt oder in das Schweizerische Staatsgebiet verbringt, kann mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder einer Geldstrafe bestraft werden.
- Wenn der Täter fahrlässig handelt, so ist die Strafe eine Busse. In leichten Fällen kann von einer Bestrafung abgesehen werden.
- Mit einer Busse im Sinne einer Übertretung bestraft wird eine Person, die die Sorgfaltspflichten bei der Übertragung von Waffen missachtet, die Waffen ohne Bewilligung importiert, den Verlust einer Waffe nicht der Polizei meldet oder die verbotenen Formen des Anbietens verwendet.
- Drohungen
Fokus Sexuelle Gewalt
- Illegale Pornografie
Laden Sie die Bilder auf keinen Fall herunter und machen Sie keine Screenshots. Sie machen sich sonst mit dem Download von Kinderpornografie oder Screenshots strafbar!
Melden Sie den von Ihnen notierte oder in den Zwischenspeicher kopierten Link der Online-Meldestelle gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen.Gemäss einem Entscheid des Bundesgerichts wird Pornografie allgemein folgendermassen definiert: „Der Begriff der Pornographie setzt einerseits voraus, dass die Darstellungen oder Darbietungen objektiv betrachtet darauf ausgelegt sind, den Konsumenten sexuell aufzureizen. Zum anderen ist erforderlich, dass die Sexualität so stark aus ihren menschlichen und emotionalen Bezügen herausgetrennt wird, dass die jeweilige Person als ein blosses Sexualobjekt erscheint, über das nach Belieben verfügt werden kann. Das sexuelle Verhalten wird dadurch vergröbert und aufdringlich in den Vordergrund gerückt.“
Das Gesetz benennt zwei Formen von Pornografie, die generell unter Strafe gestellt werden: Pornografische Darstellungen mit Kindern und mit Tieren.
Wenden Sie sich an eine spezialisierte Beratungsstelle oder suchen Sie eine Therapeutin oder einen Therapeuten. Anerkannte Berufspersonen finden Sie bei der Föderation der Schweizer Psychologinnen und Psychologen.
Darstellungen einvernehmlicher sado-masochistischer Praktiken sind in der Regel nicht verboten. Zur Anzeige gebrachte Darstellungen mit Gewalttätigkeiten unterstehen der freien richterlichen Würdigung und werden im Einzelfall geprüft. Auch wenn Pornografie mit Gewalt nicht mehr unter Strafe steht, können Gewaltdarstellungen, auch pornografische, unter Art. 135 StGB angezeigt werden.
Nein. Mit der Revision des Tierschutzgesetzes im September 2008 ist Sex mit Tieren unter Strafe gestellt worden.
Ja, in Artikel 197 StGB ist eindeutig formuliert, dass auch Darstellungen «nicht tatsächlicher sexueller Handlungen mit Minderjährigen» unter Strafe stehen. Die Idee dahinter ist, dass der Konsum von Kinderpornografie möglicherweise Nachahmungstaten zur Folge haben kann und es somit (ausser beim Strafmass) keine Rolle spielt, ob die Minderjährigen «echt» sind oder «nur» virtuell.
- Sexuelle Gewalt an Erwachsenen
Das Bundesamt für Statistik veröffentlicht jährlich die Polizeiliche Kriminalstatistik, die Auskunft zu den polizeilich gemeldeten Straftaten gibt. Auch die Verurteilungen gemäss Strafartikel können nachgeschaut werden. Die Statistiken geben aber nur Auskunft über das so genannte Hellfeld, das heisst über Straftaten, die den Behörden gemeldet wurden. Da Sexualdelikte schambehaftet sind, werden sie oft nicht zur Anzeige gebracht und verbleiben im so genannten Dunkelfeld.
Sexuelle Gewalt an Erwachsenen umfasst jede Form von erzwungenen sexuellen Handlungen und grenzverletzendem Verhalten mit sexuellem Bezug. Sie kommt als sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz, als sexuelle Ausbeutung in einer Abhängigkeitsbeziehung (z.B. im Angestelltenverhältnis) oder als erzwungener Geschlechtsverkehr in der Ehe oder in Partnerschaften vor. Bei sexueller Gewalt handelt es sich – neben der erzwungenen Befriedigung sexueller Bedürfnisse – oft um eine Form von Machtausübung, Erniedrigung und Demütigung.
Im Notfall: Melden Sie sich so rasch wie möglich bei der Polizei (Notrufnummer 117).
Zum Schutz der sexuellen Unversehrtheit im öffentlichen Raum gelten für alle gleichermassen folgende Tipps:
- Meiden Sie Kontakt mit Betrunkenen oder mit Menschen unter Drogeneinfluss. Auch eigener übermässiger Alkohol- oder anderer Drogenkonsum kann gefährlich sein, vor allem, wenn man alleine unterwegs ist.
- Lassen Sie Ihren Drink nicht unbeaufsichtigt. Achten Sie auf Ihr Getränk, damit Sie verhindern, dass eine Substanz wie K.O.-Tropfen ohne Ihr Wissen hineingetan wird.
- Falls Sie doch angegriffen werden: Schreien Sie laut, beissen Sie, reissen Sie sich los, schlagen Sie um sich, treten und boxen Sie, wenn Sie angegriffen werden. Gegenwehr ist der sicherste Weg zur erfolgreichen Abwehr sexueller Gewalt.
Zum Schutz der sexuellen Unversehrtheit im Ausgang informieren Sie sich auch auf der Seite zu unserer Kampagne Gut ausgegangen?.
Sexuelle Gewalt geht auch unter Erwachsenen öfter von bekannten Personen aus. Zum Schutz der sexuellen Unversehrtheit im privaten Bereich informieren Sie sich dazu auf der Themenseite Häusliche Gewalt.
Informieren Sie sich auch auf der Seite zu unserer Kampagne «Gemeinsam ohne sexuelle Gewalt».
Bei Sexualstraftaten ist es wichtig, dass sich das Opfer so rasch als möglich (<72 Std.) in rechtsmedizinische Untersuchung begibt und vorher möglichst keine Spuren verwischt resp. entfernt, auch wenn dies sehr belastend sein kann. Mit der rechtsmedizinischen Beweissicherung geht keine Meldung an die Polizei einher, das Opfer kann weiterhin selbst entscheiden. Wenn aber – auch zu einem späteren Zeitpunkt – eine Anzeige gemacht werden will, werden die von den Spezialist:innen gesicherten Sachbeweise den zuständigen Behörden zur Verfügung gestellt. Für die Ermittlung ist die Beweissicherung für die spätere Beweisführung zentral. Manche Spitäler verfügen über speziell geschultes Personal, wie Forensic Nurses, um Betroffene von sexueller Gewalt fachgerecht zu betreuen und Beweise zu sichern.
Opfer von sexueller Gewalt können sich unabhängig von einer Strafanzeige bei der Opferhilfe melden. Dort werden Opfer rechtlich, psychologisch und auch bezüglich eines Ermittlungsverfahrens beraten. Opfer eines Sexualdeliktes haben im Strafverfahren bestimmte Informations- und Schutzrechte. Die Polizei und die Opferhilfe informieren im Detail darüber.
Bei allen Fällen von sexueller Gewalt und sexueller Belästigung, von der verbalen Beleidigung über unerwünschte Konfrontationen mit sexuellen Inhalten in den Medien, Exhibitionismus-Vorfälle bis hin zu ungewünschten Körperkontakten, haben Sie die Möglichkeit, sich bei der Polizei für eine allfällige Anzeige zu melden.
Die Polizei ermittelt bei sexuellen Handlungen bei Kenntnis der Sachlage von Amtes wegen (mit Ausnahme der sexuellen Belästigung, die ein Antragsdelikt ist). Wenn die Polizei über eine vermutete Sexualstraftat in Kenntnis gesetzt wird, werden folgende Prozesse in Gang gesetzt: Die Polizei trägt unter Leitung der zuständigen Staatsanwaltschaft die Beweise zusammen (z.B. Befragung von Auskunftspersonen und Zeugen, rechtsmedizinische Untersuchungen etc.). Eine allfällig tatverdächtige Person kann infolgedessen in Untersuchungshaft genommen werden, besonders dann, wenn Fluchtgefahr oder Wiederholungsgefahr besteht. Je mehr Beweismaterial die Polizei findet, desto leichter wird das Strafverfahren für das Opfer.
Die Aussagen des Opfers eines Sexualdeliktes sind für eine allfällige Verurteilung der beschuldigten Person von zentraler Bedeutung, vor allem, wenn keine oder kaum Sachbeweise vorliegen. Ab dem 15. Altersjahr wird ein Opfer in der Regel als Zeuge oder Zeugin von einer Polizistin resp. von einem Polizisten desselben Geschlechts wie das Opfer einvernommen. Opfer können sich bei der Einvernahme von einer Vertrauensperson begleiten lassen (z.B. von einer Opferberaterin). Wenn das Opfer zum Zeitpunkt der Eröffnung der Strafuntersuchung unter 18 Jahre alt ist, wird es maximal zwei Mal einvernommen. Eine zweite Einvernahme erfolgt nur, wenn sie unumgänglich ist.
- Sexuelle Gewalt an Kindern
Das Bundesamt für Statistik veröffentlicht jährlich die Polizeiliche Kriminalstatistik, die Auskunft zu den polizeilich gemeldeten Straftaten gibt. Auch die Verurteilungen gemäss Strafartikel können nachgeschaut werden. Die Statistiken geben aber nur Auskunft über das so genannte Hellfeld, das heisst über Straftaten, die den Behörden gemeldet wurden. Da Sexualdelikte schambehaftet sind, werden sie oft nicht zur Anzeige gebracht und verbleiben im so genannten Dunkelfeld.
Die meisten Fälle von Kindsmissbrauch finden im sozialen Nahfeld statt. Die Täter sind meistens Verwandte, Freunde der Familie, Lehrpersonen sowie Trainer und den Kindern bereits bekannt. Der Fremdtäter, der ein ihm völlig unbekanntes Kind entführt, um es sexuell auszubeuten, kommt äusserst selten vor. Viele Menschen halten jedoch diese sehr kleine Gruppe von Fremdtätern fälschlicherweise für die «typischen» Pädokriminellen.
Eine weitere falsche Einschätzung prägt den gesellschaftlichen Diskurs: Oft wird fälschlicherweise suggeriert, dass die meisten Kindsmissbraucher pädophil sind. Dies ist nicht der Fall. Es gibt viele andere Motive wie perverse Neugierde, persönliche Krisen, Machtausübung mit sexuellen Mitteln oder Sadismus, warum weshalb Menschen (in aller Regel Männer) Kinder missbrauchen. Pädophile sind Menschen, die sich sexuell ausschliesslich von Kindern angesprochen fühlen. Pädophilie ist somit eine sexuelle Orientierung bzw. eine psychiatrische Diagnose. Sie hat keine strafrechtlichen Konsequenzen, solange die sexuelle Anziehung nicht ausgelebt wird. Erst wenn es zu sexuellen Handlungen mit einem Kind kommt, machen sich diese Personen strafbar.
Die beste Prävention ist eine frühzeitige und der jeweiligen Entwicklung angepasste Aufklärung.
Das Kind sollte wissen, dass es…
- … Menschen gibt, die gleichzeitig «lieb und böse» sein können.
- … Menschen gibt, die während des Spielens fliessend zum Missbrauch übergehen.
- … das Recht hat, «Nein» zu sagen.
- … an einem sexuellen Übergriff niemals schuld ist, denn die Verantwortung liegt immer beim Erwachsenen.
Angst ist ein schlechter Ratgeber und Selbstbewusstsein ist ein wirksamer Schutz vor sexuellen Übergriffen! Machen Sie Ihrem Kind bewusst, dass es eine eigene Persönlichkeit ist, mit Grenzen, die es selbst bestimmen darf.
Sagen Sie Ihrem Kind, dass es nicht feige ist, Angst zu haben, wegzulaufen oder sich Hilfe zu holen. Das Kind soll seinem schlechten/unguten Gefühl vertrauen. Ist dem Kind eine Situation aus irgendwelchen Gründen nicht geheuer, soll es weggehen und vertraute Orte/Menschen aufsuchen.
Vermitteln Sie Ihrem Kind, dass es Ihnen alle seine Erlebnisse erzählen kann. Auch jene, die ihm merkwürdig oder beängstigend vorkommen oder jene, die zustande kamen, weil das Kind nicht gehorcht hat (z.B. anderer Schulweg). Nehmen Sie sich Zeit, mit Ihrem Kind über seine Erlebnisse und Sorgen zu sprechen.
Pünktlichkeit ist eine Tugend: Erklären Sie Ihrem Kind, weshalb es wichtig ist, dass es immer den vereinbarten Schulweg geht und möglichst pünktlich zu Hause, in der Schule, im Hort etc. ist.
Zeigen Sie Interesse und fragen Sie bei Auffälligkeiten nach. Interessieren Sie sich für den Bekannten- und Freundeskreis Ihres Kindes und deren gemeinsame Aktivitäten. Fragen Sie nach, wenn Ihr Kind plötzlich neue Sachen besitzt oder von netten neuen Freunden erzählt, die deutlich älter sind.
- Falls trotz aller Vorsicht etwas passiert ist oder passiert sein könnte, ist es wichtig, besonnen zu reagieren. Berichtet ein Kind von Beobachtungen, (unangenehmen) Erfahrungen, Übergriffen, Drohungen etc., glauben Sie ihm und hören Sie aufmerksam zu.
- Loben Sie es, weil es sich Ihnen anvertraut hat. Schimpfen Sie nicht, falls das Kind etwas falsch gemacht hat. Es wird sich sonst nicht mehr an Sie wenden.
- Melden Sie diese konkreten Beobachtungen oder Erfahrungen Ihres Kindes der Polizei. Die Polizei ist auf solche Hinweise angewiesen.
- Sollte Ihr Kind nicht zum erwarteten Zeitpunkt heimkehren, erkundigen Sie sich unverzüglich bei seiner Lehrperson, bei Freundinnen oder Freunden. Falls Ihr Kind unauffindbar bleibt, wenden Sie sich sofort über die Notfallnummer 117 an die Polizei. Die Polizei nimmt jede Meldung ernst und geht ihr unverzüglich nach.
- Illegale Pornografie
Fokus Internet
- Cybermobbing
Wenn mehrere Täter und/oder Täterinnen eine Person im Internet oder mittels Smartphones über einen längeren Zeitraum absichtlich beleidigen, bedrohen, blossstellen oder belästigen, spricht man von Cybermobbing.
- die Verbreitung von falschen Informationen und Gerüchten
- die Verbreitung von peinlichen, verfälschten, freizügigen oder pornografischen Fotos und Videos
- das Erstellen von (beleidigenden) Fakeprofilen
- das Beschimpfen, Belästigen, Bedrohen und Erpressen via E-Mail, SMS etc.
- die Gründung von «Hassgruppen», in denen wie in einem Gästebuch negative Äusserungen über Einzelpersonen gemacht werden können.
Cybermobbing ist immer mit einem Mangel an Sozial- und Medienkompetenz verknüpft. Den Täterinnen und Täter mangelt es an Empathie für das Opfer oder es ist ihnen gleichgültig. Mobberinnen und Mobber erhöhen ihre Stellung in der Gruppe, indem sie andere blossstellen und beschimpfen. Manchmal wird die mangelnde Medienkompetenz des Opfers von den Täterinnen und Tätern ausgenutzt: Gewisse Opfer sind im Vorfeld der Cybermobbing-Attacken unsorgfältig mit ihren Passwörtern umgegangen und haben sich vor dem Posten von Fotos, Videos und anderen Inhalten zu wenig informiert oder überlegt, welche Personen diese Posts sehen, verbreiten und missbrauchen könnten.
Cybermobbing betrifft vor allem Kinder und Jugendliche und hat seinen Ursprung oft in der Schule resp. in der Offline-Welt. Obwohl die Täterinnen und Täter manchmal die Anonymität des Internets nutzen, um ihre Identität zu verschleiern, stammen sie in der Regel aus dem Bekanntenkreis des Opfers.
Durch die altersgerechte Vermittlung von Medienkompetenz und indem man mit ihnen über Cybermobbing und seine Folgen spricht. Siehe dazu «My little Safebook» und «Es war einmal…das Internet»
- Sichern Sie Beweise für Cybermobbing-Attacken. Erstellen Sie Printscreens von Webseiten, speichern Sie Chatverläufe, SMS, Benutzernamen und dergleichen.
- Besprechen Sie den Cybermobbing-Fall mit der Klassenlehrerin/dem Klassenlehrer und/oder mit dem Schulsozialdienst. Bestehen Sie darauf, dass sich auch die Klassenlehrperson um die Lösung und Aufarbeitung des Cybermobbings bemüht, insbesondere dann, wenn die involvierten Schülerinnen und Schüler dieselbe Klasse oder Schule besuchen.
- Wenn die Cybermobbing-Attacke nach der Kontaktaufnahme mit den Involvierten und deren erwachsenen Bezugspersonen nicht unverzüglich aufhört, nehmen Sie externe Hilfe in Anspruch. Wenden Sie sich zum Beispiel an eine Opferhilfestelle oder eine Jugendberatungsstelle in Ihrem Kanton und überlegen Sie mit diesen Expertinnen und Experten, ob Sie bei der Polizei an Ihrem Wohnort Anzeige erstatten und/oder Strafantrag stellen wollen oder nicht.
- Sprechen Sie mit Ihrem Kind über die Folgen von Cybermobbing für das Opfer und klären Sie es über mögliche strafrechtliche Folgen für die Täter von Cybermobbing auf.
- Verlangen Sie von ihm, dass es unverzüglich aufhört, sich an den Cybermobbing-Attacken zu beteiligen.
- Überlegen Sie gemeinsam, wie sich ihr Kind am besten beim Opfer entschuldigt und wie es das begangene Unrecht wieder gut machen kann.
- Falls Sie davon ausgehen müssen, dass weitere Kinder an den Cybermobbingattacken beteiligt sind oder falls Sie den Verdacht haben, dass ihr Kind das Cybermobbing nicht eingestellt hat, informieren Sie die Klassenlehrperson. Besprechen Sie mit ihr die weiteren Schritte.
Falls Cybermobbing in einem konkreten Fall mit Erpressung nach Art. 156 StGB oder Nötigung nach Art. 181 StGB einhergeht, werden die entsprechenden Taten von der Polizei von Amtes wegen verfolgt, sobald sie Kenntnis davon hat. Dies geschieht unabhängig davon, ob das Opfer die strafrechtliche Verfolgung der Täterinnen und Täter will oder nicht!
Andere, «leichtere» Straftaten, die in Zusammenhang mit Cybermobbing begangen wurden (z.B. Beschimpfung nach Art. 177 StGB), werden nur verfolgt, wenn das Opfer (oder seine gesetzliche Vertretung) einen Strafantrag bei der Polizei stellt.
- Hacking + Malware
Ein E-Banking-Trojaner ist eine Art von Malware. Diese Form von Schadsoftware infiziert einen Computer gezielt, um E-Banking-Sitzungen zu übernehmen und unbemerkt Geld-Transaktionen auf in- und ausländische Konten auszulösen.
Spyware (spy = engl. für Spion) ist eine Art von Malware. Ist ein Computer mit Spyware infiziert, so kann das Programm die Tätigkeiten des Nutzers nachverfolgen (z. B. besuchte Webseiten) und die Benutzerdaten dem Täter per Internetverbindung übermitteln.
Rogueware (rogue = engl. für Schurke) oder Scareware (scare = engl. für Schreck) ist eine Form von Malware, die gefälschte Antivirenprogramme anbietet. Falsche Antivirenprogramme warnen das Opfer, dass sein Computer angeblich infiziert sei und eine zusätzliche Software gekauft werden müsse. Auf dieser zusätzlichen Software befindet sich dann die Schadsoftware.
Bei Ransomware (ransom = engl. für Lösegeld), die auch unter dem geläufigeren Begriff Erpressungstrojaner oder Verschlüsselungstrojaner bekannt ist, handelt es sich um eine bestimmte Familie von Malware, die Computerdateien und verbundene Netzlaufwerke verschlüsselt und unbrauchbar macht. Betroffene können danach ihren Computer nicht mehr benutzen und der Zugriff auf ihre persönlichen Daten ist gesperrt. Dies zeigt sich über einen Sperrbildschirm. Darauf ist zu lesen, dass eine bestimmte Geldsumme in Form einer Internetwährung (z.B. Bitcoins) an die Hacker zu bezahlen sei, damit diese die verschlüsselten Dateien wieder freigeben und der Computer wieder benutzt werden kann. Wer auf die erpresserischen Forderungen der Hacker eingeht, hat keine Garantie, den Zugang zu den verschlüsselten Dateien wieder zu erhalten.
Eine «Drive-By-Infektion» bedeutet die Infektion eines Computers mit Malware allein durch den Besuch einer kompromittierten Web-Seite. Dabei kann es sich durchaus auch um seriöse und vielbesuchte Seiten handeln, die unbemerkt für betrügerische Zwecke missbraucht werden.
Unter DDoS (Distributed Denial of Service = engl. für Verweigerung des Dienstes) versteht man einen Angriff auf Computer-Systeme mit dem Ziel, deren Verfügbarkeit zu stören. Der Angriff kann dabei auf Netzwerkebene, auf Anwendungsebene oder einer Kombination davon erfolgen. In der Regel werden für solche Attacken sogenannte Bot-Netze (eine riesige Anzahl «gekaperter» Systeme, die vom Angreifer ferngesteuert werden können) oder schlecht konfigurierte Drittsysteme (z. B. Open DNS Resolver) verwendet, die durch manipulierte Anfragen dazu gebracht werden, grosse Antworten an die «falsche» Adresse – nämlich die des Zielsystems – zu schicken (Amplification-Angriffe). Das Datenvolumen ist dabei so riesig, dass einzelne Organisation es ohne fremde Hilfe in der Regel nicht mehr bewältigen kann. Die Motivation hinter solchen DDoS-Attacken sind meistens politischer Aktivismus, Erpressung oder Schädigung eines Konkurrenten.
- Misstrauen Sie E-Mails, deren Absenderadresse Sie nicht kennen.
- Klicken Sie in verdächtigen E-Mails auf keine Anhänge und folgen Sie keinen Links.
- Öffnen Sie nur Dateien oder Programme aus vertrauenswürdigen Quellen und nur nach vorgängiger Prüfung mit einer aktuellen Antiviren-Software.
- Antworten Sie nicht auf Spam. Wird auf Spam geantwortet, so weiss der Sender, dass die E-Mail-Adresse gültig ist und wird weiter Spam verschicken.
- Die Mindestlänge des Passwortes sollte bei acht Zeichen liegen und sowohl aus Buchstaben, Zahlen wie auch Sonderzeichen bestehen.
- Das Passwort ist so zu wählen, dass man es sich einfach merken kann. Schreiben Sie keine Passwörter auf. Gute Passwörter bestehen aus ganzen Sätzen, die ebenfalls Sonderzeichen enthalten, wie zum Beispiel «Dieses P@ssw0rt vergesse 1ch nie!!».
- Verwenden Sie verschiedene Passwörter für verschiedene Zwecke (z. B. für unterschiedliche Benutzerkonten). Bei der Nutzung von Online-Diensten wird dringend empfohlen, jeweils andere Passwörter zu verwenden.
- Ein Passwort sollte gewechselt werden, wenn Sie vermuten, dass es Dritten bekannt sein könnte.
- Laden Sie keine Programme (z.B. Spiele) aus unbekannten Quellen vom Internet herunter. Klicken Sie auf «Abbrechen» oder «Nein», wenn ein ungewolltes Download-Fenster erscheint.
- Laden Sie Software-Updates oder Treiber ausschliesslich von der Webseite des jeweiligen Herstellers herunter. Prüfen Sie diese anschliessend mit einer aktuellen Antiviren-Software.
Technische Massnahmen wie eine Personal-Firewall, regelmässige Software-Updates und die Installation einer Antiviren-Software können massgeblich zur Erhöhung der Sicherheit eines jeden Computers beitragen. Ihre Daten sollten jedoch nicht nur sicher auf dem Computer aufbewahrt sein, sondern auch regelmässig auf einem externen Datenträger abgespeichert werden. Nur so können Sie im Falle einer Zerstörung Ihrer Daten zumindest einen Teil davon wieder herstellen.
- Phishing
Das Wort Phishing setzt sich aus den englischen Begriffen «Password», «Harvesting» (dt. Ernten) und «Fishing» zusammen. Wie der Name bereits andeutet, ist Phishing eine Technik, um an vertrauliche Daten von ahnungslosen Internet-Nutzern und -Nutzerinnen zu gelangen. Dabei kann es sich zum Beispiel um die Zugangsdaten von E-Mail-, Post-, E-Banking- oder Online-Auktionsanbieter-Konten handeln. Phishing-Angriffe können von organisierten Banden aber auch von Einzelpersonen ausgehen und finden über E-Mail, Webseiten, Internet-Telefonie (VoIP) oder SMS statt.
In vielen Fällen nutzen die Betrüger die Gutgläubigkeit und Hilfsbereitschaft der Benutzerinnen und Benutzer aus, indem sie ihnen E-Mails mit gefälschten Absender-Adressen zustellen. In den E-Mails wird die Empfängerin oder der Empfänger beispielsweise darauf hingewiesen, dass die Kontoinformationen und Zugangsdaten (z. B. Benutzernamen und Passwort) nicht mehr sicher oder aktuell seien und man diese unter dem im E-Mail aufgeführten Link ändern solle. Der Link führt jedoch nicht auf die Originalseite des angegebenen Dienstleistungsanbieters, sondern auf eine oft täuschend echt gefälschte Webseite.
Betrüger verwenden die erschlichenen und gestohlenen Daten für verschiedene Vermögensdelikte: Sie tätigen im Namen der bestohlenen Person Banküberweisungen, kaufen online ein oder platzieren sogar gefälschte Angebote bei Online-Auktionsanbietern. Die erschlichenen E-Mail-Zugangsdaten ermöglichen den Betrügern zudem vollen Zugriff auf deren E-Mail-Konto. Auf diese Weise können Betrüger weitere betrügerische E-Mails an die Kontakte des Betroffenen senden, das Passwort ändern oder das Konto sperren.
Seriöse Dienstleister wie Banken, die Post, Online-Auktionsanbieter, Behörden oder ähnliche Institutionen werden Sie nie über E-Mail oder Telefon zur Angabe von Passwörtern oder Kreditkartendaten auffordern. Seien Sie deshalb äusserst misstrauisch, wenn Sie E-Mails bekommen, die persönliche Daten verlangen und mit Konsequenzen wie Geldverlust, Strafanzeige oder Kartensperrung drohen.
- Seriöse Dienstleister wie Banken, die Post, Online-Auktionsanbieter, Behörden oder ähnliche Institutionen werden Sie nie über E-Mail oder Telefon zur Angabe von Passwörtern oder Kreditkartendaten auffordern. Seien Sie deshalb äusserst misstrauisch, wenn Sie E-Mails bekommen, die persönliche Daten verlangen und mit Konsequenzen wie Geldverlust, Strafanzeige oder Kartensperrung drohen. Löschen Sie solche E-Mails konsequent ohne auf Links zu klicken oder zu antworten.
- Installieren Sie ein Anti-Phishing-Programm und updaten Sie dieses regelmässig.
- Melden Sie den Phishing-Angriff MELANI über das entsprechende Meldeformular.
- Falls Sie vertrauliche Daten preisgegeben haben, nehmen Sie umgehend Kontakt mit Ihrem Dienstleistungsanbieter (Finanzinstitut, Provider oder E-Mail-Dienst) auf und schildern Sie Ihre Situation, damit Sie die Kontrolle über Ihre Daten wieder erlangen. Melden Sie den Phishing-Angriff ausserdem MELANI über das entsprechende Meldeformular.
- Ändern Sie sofort die kommunizierten Passwörter und erstellen Sie neue und sichere Passwörter.
- Sextortion
Sextortion bezeichnet eine Erpressungsmethode, bei der eine Person mit Bild- und Videomaterial erpresst wird, auf welchem sie beim Vornehmen sexueller Handlungen (Masturbation) und/oder nackt zu sehen ist.
Der Begriff Sextortion setzt sich aus «Sex» und «Extortion» (engl. Erpressung) zusammen.
Der Begriff Sexting setzt sich aus «Sex» und «Texting» (engl. SMS schreiben) zusammen. Damit ist das Versenden von sexualisierten Selfies oder Nacktaufnahmen im privaten Kontext gemeint. Bei Sextortion hingegen wird eine Person von kriminellen Gruppierungen mit Bild- und Videomaterial, auf dem sie beim Vornehmen sexueller Handlungen zu sehen ist, erpresst.
In erster Linie auf Online-Dating-Plattformen und Facebook, aber grundsätzlich kann kein soziales Netzwerk ausgeschlossen werden.
Der bezahlte Betrag ist keine Garantie dafür, dass das Bild- und Videomaterial nicht doch verbreitet wird! Ausserdem geht die Erpressung nach der ersten Zahlung oft weiter und es wird noch mehr Geld gefordert.
Wenden Sie sich so schnell als möglich an die betreffende Plattform und verlangen Sie umgehend die Löschung der sexuellen Inhalte. Richten Sie einen Google Alert mit Ihrem Namen ein. Auf diese Weise werden Sie über neue Videos und Fotos, die mit Ihrem Namen im Internet hochgeladen werden, informiert.
Sextortion geht mit der Erpressung der gefilmten Person einher. Erpressung nach Art. 156 StGB ist ein Offizialdelikt. Ein Offizialdelikt ist eine Straftat, die die Strafverfolgungsbehörde von Amts wegen verfolgen muss, sobald sie Kenntnis davon hat.
Gehen Sie nicht auf die Forderung der Erpresser ein: Zahlen Sie nicht!
Brechen Sie den Kontakt zur Frau und zu den Erpressern sofort ab. Löschen Sie sie aus Ihrer Freundesliste und reagieren Sie nicht auf Mails, SMS und dergleichen.
Falls die Erpresser Bild- und Videomaterial veröffentlicht haben, wenden Sie sich so schnell als möglich an die betreffende Plattform (Youtube, Facebook etc.) und verlangen Sie umgehend die Löschung der sexuellen Inhalte.
Richten Sie einen Google Alert mit Ihrem Namen ein. Auf diese Weise werden Sie über neue Videos und Fotos, die mit Ihrem Namen im Internet hochgeladen werden, informiert.
Sichern Sie alle Beweise: Das Bild- und Videomaterial, mit welchem Sie erpresst werden, die Kontaktdaten der Erpresser und der Frau, sämtliche Nachrichten, die Sie von ihnen erhalten haben (Chatverläufe, E-Mails etc.), Angaben für Transaktion etc. und erstatten Sie Anzeige bei Ihrer Polizei. Überwinden Sie dazu Ihre Scham und machen Sie sich bewusst: Die Polizei ahndet Verbrechen, keine menschlichen Schwächen!Die überwiegende Mehrheit der Opfer von Sextortion ist männlich. Es handelt sich dabei sowohl um Jugendliche als auch Erwachsene.
Nehmen Sie keine Freundschaftsanfragen und Einladungen in sozialen Netzwerken an, wenn Sie die Person nicht zweifelsfrei identifizieren und aus dem realen Leben kennen.
Machen Sie sich stets bewusst, dass Sie während eines Videochats gefilmt werden könnten und verzichten Sie deshalb auf Handlungen, für welche Sie sich im Nachhinein schämen könnten.
- Cybermobbing
Fokus Betrug
- Abzocke
Abzocke ist ein umgangssprachlicher Begriff und kann auch als Handel mit erhöhten Preisen bezeichnet werden. Abzocken bedeutet in den meisten Fällen, einer schlecht informierten Person unter verwirrenden Bedingungen unverhältnismässig viel resp. überhaupt Geld für einen bestimmten Rat oder Kredit, ein gewisses Abonnement oder einen besonderen Gegenstand zu verlangen.
Abzocke ist kein Betrug und deshalb auch im strafrechtlichen Sinne nicht illegal. Damit ein Verhalten im rechtlichen Sinne als betrügerisch eingestuft wird, braucht es eine sogenannte Arglist. Die betrogene Person hätte mit bestem Wissen und Gewissen nicht herausfinden können, dass das Geschäft nicht so ist, wie es auf den ersten Blick erscheint. Bei der Abzocke hingegen hätten sich die Betroffenen grundsätzlich über das Geschäft informieren können, wenn auch unter erschwerten Bedingungen.
Es gibt zwischen Betrug und Abzocke aber immer auch einen Graubereich. Ob eine Handlung als Betrug oder „nur“ als Abzocke eingestuft wird, bestimmt in jedem Falle das Gericht.
Auch Abzocker und Abzockerinnen machen sich das Handelsportal Internet zu Nutze, indem sie Onlineshops erstellen, über die sie Waren zu überhöhten Preisen oder mit versteckten Gebühren vertreiben. Dabei gibt es ganz unterschiedliche Vorgehensweisen, wie Personen abgezockt werden können.
Nebst unerwünschten Bestellungen oder Abofallen sind zusätzliche Gebühren eine weitere Form von Abzocke. Dies kommt vor allem bei Onlineshops vor, die zwar mit der Endung «.ch» im Netz auftauchen, ihre Ware jedoch vom Ausland aus in die Schweiz liefern. Dadurch fallen weitere Gebühren wie Mehrwertsteuern oder Zollgebühren an. Diese zusätzlichen Kosten fehlen bei der ursprünglichen Preisberechnung und werden der Person erst im Nachhinein mitgeteilt.
Vor der definitiven Bestellung eines oder mehrerer Produkte muss daher immer eine Zusammenfassung der gesamten Bestellung erscheinen, damit der Kunde oder die Kundin allfällige Korrekturen vornehmen kann. Unter Umständen kann eine Person auf einem Onlineshop auch in eine Abofalle geraten, indem sie ohne darauf hingewiesen zu werden, ungewollt ein Abonnement oder wiederkehrende Lieferdienste abschliesst.
Wenig seriöse oder gar betrügerische Unternehmen im Finanzbereich versuchen neue Kunden und Kundinnen zu akquirieren, indem sie ihnen Kredite anbieten, die trotz ausstehender Betreibungen und ohne jegliche Bonitätsprüfung und auf den ersten Blick teils zu sehr niedrigen Zinsen bezogen werden können. Die Angebote scheinen auf den ersten Blick zwar vielversprechend, doch der Schein trügt. In der Schweiz müssen alle Finanzinstitute von Gesetzes wegen zuerst die Kreditwürdigkeit einer jeden Person überprüfen, bevor sie einen Kredit vergeben dürfen. Offene Betreibungen führen in der Regel nun einmal dazu, dass eine Person als nicht kreditwürdig eingestuft wird und deshalb keinen Kredit erhält. Verstösst ein Finanzinstitut gegen diese Vorgaben, so kann sie rechtlich belangt werden.
Mit Roaming ist die Nutzung von ausländischen Netzen mittels Smartphone, Tablet oder Notebook gemeint. Die Roaming-Kosten im Ausland können beim Surfen im Internet via Smartphone, Tablet oder Notebook sehr rasch in schwindelerregende Höhen schnellen. Im Allgemeinen wird Roaming im Ausland immer gefragter, da viele Anwender und Anwenderinnen auch in den Ferien oder während einer Geschäftsreise nicht mehr auf die Vorteile des permanenten Internetzugriffs via Smartphone, Tablet oder Notebook verzichten wollen. Um die persönliche Handyrechnung nicht unnötig mit Roaming-Gebühren zu belasten, ist es wichtig, die folgenden Ratschläge zu beachten:
- Schalten Sie die Roaming-Funktion auf Ihrem Smartphone aus, sobald Sie ins Ausland reisen. Wenn Sie in dieser Zeit keinen permanenten mobilen Internetzugang benötigen, sollten Sie diese Funktion am besten direkt am Smartphone ausschalten oder beim Anbieter deaktivieren lassen. So kommt es nicht unbemerkt zu teuren Downloads, währendem Sie im Ausland weilen.
- Nutzen Sie im Ausland, wenn möglich, kostenloses WLAN. Hotels, aber auch Cafés oder öffentlichen Einrichtungen bieten ihren Kundinnen und Kunden oftmals ihre WLAN-Netzwerke zur freien Nutzung an. Seien Sie sich dabei aber bewusst, dass nicht alle WLAN-Netzwerke gleich sicher sind.
- Informieren Sie vor einer Reise über die anfallenden Kosten im Zielland. Die Kosten für Roaming sind nicht in allen Ländern gleich.
Es kommt immer wieder vor, dass Schweizer Haushalte wegen einer vermeintlichen Urheberrechtsverletzung angeblich im Auftrag der Rechteinhaber Abmahnungen von Anwaltskanzleien aus dem Ausland erhalten. Gegenstand der Briefe ist in den meisten Fällen eine angeblich offene Rechnung. Betroffen von solchen Abmahnungen sind zum Beispiel Personen, denen vorgeworfen wird, illegal Musik oder Filme aus dem Netz heruntergeladen zu haben oder auf ihren Blogs Bilder posten, die ihnen nicht gehören. Diesbezüglich gilt es jedoch festzuhalten, dass in der Schweiz das Herunterladen von Musik und Filmen zum persönlichen Gebrauch nicht per se einen Gesetzesbruch darstellt. Grundsätzlich sind Kanzleien, die mit solchen Methoden arbeiten, daran interessiert, möglichst viel Geld zu verdienen – egal ob zu Recht oder nicht. Aus Angst vor weiteren Rechnungen zahlen daher viele Beschuldigte lieber den verlangten Betrag anstatt dass sie rechtliche Schritte gegen die Kanzlei einleiten.
Abofallen sind auch in der Pornoindustrie ein beliebtes Mittel, um einfach an Geld zu gelangen. Personen, die mit ihrem Smartphone auf Pornoseiten surfen, können mit einem Klick auf das falsche Werbebanner, das beispielsweise auf einen Video verweist, unwissentlich einen teuren Erotik-Dienst abonnieren. Es folgen Kurznachrichten des Anbieters, der nun die Handynummer der Person kennt und sich via WAP-Billing auf die Handyrechnung der Person setzten lässt.
Sucht man im Internet nach einem Online-Routenplaner, um eine Autofahrt zu planen, so landet man unter Umständen auf dubiosen Webseiten wie routenplaner-maps.online oder dergleichen. Es gibt viele solcher Seiten, die sich aus optischer Sicht ähneln und Personen gleichsam in eine Abofalle zu locken versuchen. Um die gewünschte Route mit Hilfe des jeweiligen Online-Routenplaners zu berechnen, muss eine Person als erstes ihre E-Mail-Adresse angeben und die Nutzungsbedingungen akzeptieren, die allerdings nirgends auf der Webseite angezeigt werden. Erst dann kann der Online-Routenplaner tatsächlich genutzt werden. Im Anschluss an die Registrierung erhält die Person vom Anbieter eine E-Mail mit einer Zahlungsaufforderung für den Online-Routenplaner. In der Regel geht es dabei um einige hundert Euro für ein angebliches Abonnement über mehrere Monate.
Regelmässig gelangen Sendungen in den Umlauf mit der Aufschrift «Sie haben gewonnen» oder «Ihr grosser Rätselgewinn im August», die an vermeintliche Gewinner eines Preisausschreibens adressiert sind. Grundsätzlich ist gegen Gewinnversprechen nichts einzuwenden, solange sie effektiv eingehalten werden und dafür keine Gegenleistung erwartet wird und falls auch wirklich an einer Lotterie mitgespielt wurde. Falls das Schreiben jedoch eine Person dazu auffordert, ihren Gewinn abzuholen, eine finanzielle Gegenleistung für den Gewinn zu erbringen oder auf eine kostenpflichtige Telefonnummer anzurufen, dann ist Vorsicht geboten.
Immer wieder versuchen sogenannte Registerhaie mit dem sogenannten Adressbuchschwindel an Geld zu kommen. Selbstständigerwerbende oder kleinere KMUs erhalten hierbei eine Aufforderung, sich in ein (Branchen-)Register eintragen zu lassen, meist per Fax, manchmal aber auch via Telefon oder E-Mail. Oftmals sind die Angaben der ausgewählten Personen oder Firma bereits im Formular eingetragen. Die Betroffenen werden anschliessend aufgefordert, die Angaben zu überprüfen und das Formular unterschrieben zurückzusenden. Unterzeichnet die Person das Schriftstück und schickt es zurück, dann gilt der Vertrag zwischen dem Registerhai und der jeweiligen Person als abgeschlossen. Diese erklärt sich somit angeblich einverstanden, für einen wertlosen Eintrag in einem «offiziellen» Register zu bezahlen. Obwohl das Angebot scheinbar gratis ist, findet sich im Kleingedruckten ein Hinweis darauf, dass jegliche Einträge kostenpflichtig sind.
Eine Person, die von Abzocke betroffen ist, hat die Möglichkeit, eine Strafanzeige bei der Polizei oder Staatsanwaltschaft wegen unlauteren Wettbewerbs einzureichen oder ein Zivilverfahren anzustreben. Dies ist jedoch eine langwierige und kostspielige Angelegenheit und dürfte sich kaum je lohnen im Vergleich zum Betrag, den man den Abzocker und Abzockerinnen schuldig ist. Trotzdem kann es helfen bei einem Polizeiposten vorstellig zu werden, denn diese ist oftmals daran interessiert, die unterschiedlichen Formen von Abzocke in Erfahrung zu bringen und die Bevölkerung dafür zu sensibilisieren.
- Betrug
Aus rechtlicher Sicht spricht man von Betrug, wenn jemand in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt.
In der Regel gibt sich der Betrüger beim Enkeltrick als Verwandter (z.B. Enkel oder Neffe) aus, der sich in einer finanziellen Notlage befindet und dringend die Hilfe seiner Familie benötigt.
Der Enkeltrick läuft in aller Regel nach folgendem Schema ab:- Das Opfer erhält einen Telefonanruf von einem vermeintlichen Verwandten. Hierbei sind die Betrüger und Betrügerinnen sehr geschickt, dem Opfer selbst sowohl den Namen als auch die Lebensumstände des vermeintlichen Verwandten zu entlocken und diese Informationen später ins Gespräch einzuflechten. Sie können zum Beispiel das Telefonat mit dem Satz «Hallo Margrit, rate mal, wer dran ist!» beginnen. Woraufhin, das Opfer zu raten beginnt und sobald eine Name und die Verwandtschaftsbeziehung geklärt wurde durch hilfreiche persönliche Offenbarungen wie beispielsweise «Ah, du bist der Rolf, der Enkel meiner Schwester», können die Betrüger mit ihrer erfundenen Geschichte loslegen.
- Der vermeintliche Verwandte erzählt eine komplizierte Geschichte, warum er jetzt dringend Geld braucht. Ziel der Geschichte ist, das Opfer in Sorge um den vermeintlichen Verwandten zu versetzten und Zeitdruck aufzubauen.
- Der Betrüger bittet das Opfer dann um ein Darlehen. Dabei gehen die Täter besonders raffiniert vor und versuchen im Gespräch in Erfahrung zu bringen, wie viel Geld das Opfer aufbringen könnte.
- Anschliessend präsentiert der Betrüger eine zweite komplizierte Geschichte, warum er das Geld nicht selbst in Empfang nehmen kann, sondern eine vermeintliche Freundin, ein Mitarbeiter oder Ähnliches vorbeikommt oder das Opfer sogar bis zur Bank begleiten wird.
- Zum Schluss wird eine Form von Zeitdruck erzeugt, d.h. es muss zu einer sofortigen Übergabe des Geldes kommen. Nachdem das Opfer nunmehr in Angst oder zumindest Sorge um das Wohlergehen des vermeintlichen Verwandten ist, wird weiterer Druck erzeugt, indem das Ganze eine dringliche Dimension erhält. Dies soll verhindern, dass das Opfer mit jemandem darüber spricht, sich Rat holt oder die Angelegenheit überdenkt.
- Seien Sie immer misstrauisch, wenn Sie einen angeblichen Verwandten am Telefon nicht sofort erkennen. Stellen Sie ihm Fragen, die nur echte Familienmitglieder richtig beantworten können.
- Nennen Sie niemals die Namen Ihrer Verwandten am Telefon. Sagen Sie bei angeblichen Notfällen, Sie müssten erst Rücksprache halten, und legen Sie einfach den Hörer auf. Dann wählen Sie eine Ihnen vertraute Nummer aus Ihrer Familie und überprüfen die Information.
- Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Unbekannte! Wenn Sie einem Verwandten etwas schenken wollen, dann tun Sie das immer persönlich.
- Geben Sie niemandem Auskunft über Ihr Vermögen im Haus oder auf Ihren Bankkonten.
- Wenn Ihnen ein Anrufer verdächtig vorkommt, informieren Sie sofort die Polizei (Notruf 117).
- Für Altersheime und Angehörige von Hochbetagten ist es wichtig, die Telefonnummern der Hochbetagten nicht zu veröffentlichen oder an unbekannte Personen weiterzugeben.
- Informieren Sie Ihre Verwandten und Bekannten über den Enkeltrick, indem Sie zum Beispiel die Postkarte «Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser!» bei Ihrer Polizei bestellen.
Ähnlich wie beim Vorschussbetrug wird einer Person bei der Teilnahme an einem Schenkkreise einen Gewinn versprochen. Schenkkreise funktionieren nach dem Schneeballsystem. Das bedeutet, dass neu in den Kreis eintretende Personen diejenigen Mitglieder finanziell beschenken, welche sich bereits länger im Kreis befinden. Neumitglieder treten dem Kreis in der Hoffnung bei, zu einem späteren Zeitpunkt ebenfalls beschenkt zu werden. In einen Schenkkreis wird man aufgenommen, sobald man eine bestimmt Einlage leistet. Die Beträge reichen von mehreren hundert bis zu mehreren tausend Franken. Ist man erst einmal im Kreis aufgenommen, so nimmt man in regelmässigen Abständen an Schenktreffen teil. Währenddessen wird man von der Gruppe motiviert respektive unter Druck gesetzt, neue Mitglieder für den Schenkkreis anzuwerben. Schenkkreise fallen jedoch nach kurzer Zeit in sich zusammen, da die erforderliche Anzahl an neuen Teilnehmenden zu hoch ist. Mit dem Zusammenbruch ist auch das anfangs investierte Geld weg. Die Teilnahme an Schenkkreisen und an Kettenbriefaktionen mit Gewinnaussichten ist gemäss Lotteriegesetz verboten.
Betrügerinnen und Betrüger rufen Unternehmen und Privatpersonen an und geben sich als Mitarbeitende von Microsoft oder einer ihrer Partnerfirmen ausgeben. Die Anrufer behaupten meist aus Grossbritannien, den USA oder Australien zu stammen. Sie sprechen allerdings kein akzentfreies Englisch. Sie verwenden entweder Internettelefonie (VoIP) und können dadurch ihre Nummer fälschen, verschleiern respektive unterdrücken oder aber sie rufen via gehackte Telefonanlagen von Dritten an, wodurch sich eine Rückverfolgung oder Blockierung der Nummern schwierig gestaltet.
Im Laufe des Telefonats informieren die Anrufer die Opfer, dass sie eine Fehlermeldung bezüglich des Computers der Opfer erhalten hätten und mögliche Sicherheitsprobleme auftreten können. Als angeblicher Microsoft Support Mitarbeiter bieten die Betrügerinnen und Betrüger dem Opfer nun Supportleistungen an, um die vermeintlichen Fehler und Sicherheitsprobleme zu beheben. Um einen Fern-Zugang zum Computer des Opfers zu bekommen und so angeblich Hilfe zu leisten, senden die Betrügerinnen und Betrüger dem Opfer, ähnlich wie beim Phishing, eine E-Mail mit einem Link oder locken es auf eine betrügerische Webseite, wo das Opfer ein Programm herunterladen soll. Mit dem Klick auf den Link bzw. mit dem Herunterladen des Programms erhalten die Betrügerinnen und Betrüger Zugriff auf den Computer ihres Opfers: Sie können so unbemerkt Passwörter ausspionieren und alle auf dem Computer gespeicherten Daten einsehen und ggf. löschen, kopieren, bearbeiten etc.
Auch wenn es durchaus seriöse Haustürgeschäfte gibt, tauchen doch immer wieder einmal Betrügerinnen und Betrüger an der Haustüre auf, die mit dubiosen Haustürgeschäften Geld verdienen wollen. Man erkennt sie oft rasch an ihren Vorgehensweisen: Sie versuchen hartnäckig Einlass in die Wohnung des potentiellen Opfers zu bekommen, damit sie dieses alleine und ungestört um den Finger wickeln können. Die Betrüger und Betrügerinnen geben sich zum Beispiel als Hausiererin, Scheren- und Werkzeugschleifer, Teppich- oder Lederjackenverkäuferin aus, die an der Haustüre ein preislich interessantes Geschäft vorschlagen, wie z.B. ein besonders preiswerter Perserteppich. Oft werden an der Haustüre aber auch minderwertige Waren oder überteuerte Körperpflegeprodukte und Haushaltartikel verkauft. Hierbei greifen die Betrüger immer wieder auf die gleichen Tricks zurück:
- Die Verwendung von seriös anmutenden Firmennamen;
- Die Namen von bekannten Marken werden missbräuchlich verwendet;
- Die Verpackungen der Produkte sind aufwendig gestaltet;
- Die abgegebenen Prospekte enthalten total überhöhte Preisempfehlungen;
- Die Betrüger und Betrügerinnen versprechen lange Garantien auf den Produkten;
- Die Ware wird auf sehr überschwänglich Art und Weise angepriesen;
- Die Seriosität der Verkäufer lässt sich kaum prüfen, da die Adressen auf den Quittungen und Visitenkarten meist frei erfunden sind.
Grundsätzlich muss Ihr Widerruf keine bestimmte Form haben. Damit Sie Ihren Rücktritt vom Vertrag auch beweisen können, ist ein eingeschriebener Brief jedoch nach wie vor das beste Mittel. Ansonsten gilt: Einmal abgeschlossene Verträge sind bindend und rechtskräftig. Die Verkäuferin oder der Verkäufer muss Sie als Kundin oder Kunden grundsätzlich schriftlich über die Frist und Form des möglichen Widerrufs informieren und seine Adresse bekanntgeben. Die Frist beginnt, sobald Sie den Vertrag beantragt oder angenommen haben. Sofern Sie nicht beim Vertragsabschluss, sondern erst zu einem späteren Zeitpunkt von Ihrem Recht auf Widerruf erfahren, weil es Ihnen verschwiegen wurde, so beginnt die Frist erst dann zu laufen, wenn Sie Kenntnis davon erhalten. Bereits erhaltene Leistungen und Waren müssen Sie zurückerstatten.
Wer auf Betrügerinnen und Betrüger hereingefallen ist, sollte sich nicht schämen, die Polizei zu informieren. Betrügerinnen und Betrüger gehen teilweise sehr raffiniert vor, und jede und jeder kann unter Umständen zum Opfer werden. Obwohl es in vielen Betrugsfällen unwahrscheinlich ist, verlorenes Geld zurückzuerhalten, sollte man trotzdem bei der Polizei Anzeige erstatten. Auch diejenigen, die im letzten Moment das Täuschungsmanöver einer Betrügerin oder eines Betrügers erkannt haben (z.B. einen Enkeltrick), sollten sich umgehend bei der Polizei melden. Auf diese Weise kann die Polizei so feststellen, in welchen Gebieten sich derzeit besonders viele Betrügerinnen und Betrüger aufhalten und mit welchen Tricks derzeit viele Leute betrogen werden. Mit diesem Wissen können die kantonalen und städtischen Polizeikorps gezielt Prävention betreiben und besonders gefährdete Bevölkerungsgruppen warnen sowie ihre Präsenz an bestimmten Orten verstärken.
- Achten Sie auf die Rechtschreibung des Onlineshops. Die Rechtschreibung ist ein erstes Indiz für die Seriosität einer Webseite. Auffällig viele Fehler deuten darauf hin, dass die Seite nicht seriös gestaltet wurde und deshalb zu einem entsprechenden Anbieter gehört. Eine seriöse Firma wird sich die Mühe machen, ihre Website mit qualitativ guten Texten zu versehen.
- Achten Sie beim jeweiligen Onlineshop auf die Gütesiegel des Verband des Schweizerischen Versandhandels (VSV) und von Trusted Shops. Prüfen Sie auf den beiden Portalen ausserdem, ob der Onlineshop die Gütesiegel zu Recht bekommen hat oder ob die Siegel fälschlicherweise auf dem Onlineshop angezeigt werden.
- Prüfen Sie das unglaubliche Schnäppchen-Angebot sehr genau. Erkundigen Sie sich über den Anbieter und über mögliche Zusatzkosten wie, Zoll oder Mehrwertsteuer. Obwohl auch online gute Angebote existieren, verschenkt kein Händler seine Ware. Handelt es sich beim angeblichen Schnäppchen tatsächlich um Originalware oder wird hier gefälschte Markenware angeboten? Wenn tatsächlich gefälschte Ware verkauft wird, ist es sehr wichtig, dies den verantwortlichen Meldestellen zu melden.
- Passen Sie bei Ihnen unbekannten Händlern auf, wenn sie bei der Bezahlmöglichkeit auf Vorkasse/ Vorauszahlungen bestehen. Auf diese Weise bezahlen Sie für die Ware bevor Sie diese zugeschickt bekommen. Seriöse Händler hingegen bieten immer mehrere Zahlungsmodalitäten an, wie beispielsweise auf Rechnung oder Nachnahme oder per Kreditkarte oder PayPal.
- Ist eine Kontaktadresse zum Händler im Onlineshop vorhanden? In der Schweiz sind Anbieter im elektronischen Geschäftsverkehr nach Art. 3 Abs. 1 lit. s UWG verpflichtet, klare und vollständige Angaben über Ihre Identität zu machen und eine Kontaktadresse anzugeben. Falls die Webseite über kein Impressum mit Adresse, E-Mail und Telefonnummer des Anbieters verfügt, ist das ein Hinweis auf einen betrügerischen Onlineshop. Arbeitet der Anbieter mit der Email-Adresse eines Gratisanbieters, sind zumindest Zweifel an dessen Seriosität angebracht.
Als Vorschussbetrug bezeichnet man grundsätzlich jede Form des Betrugs, bei der ein Vorschuss geleistet werden muss, um anschliessend eine Geldsumme, ein Produkt oder eine Dienstleistung zu erhalten. Betrüger und Betrügerinnen versenden E-Mails, in denen sie auf mehr oder weniger fantasievolle Art und Weise erklären, wie man an diese Geldsumme, das Produkt oder die Dienstleistung heran kommt. Nachdem das Opfer den Vorschuss bezahlt hat, lassen die Betrüger und Betrügerinnen nicht mehr von sich hören und denken nicht im Geringsten daran, die versprochene Gegenleistung zu erbringen.
Unter den Fachbegriffen «Romance Scam» oder «Love Scam» versteht man eine Form von Vorschussbetrug, der auf Menschen mit einem starken Partnerwunsch abzielt und der sich in der virtuellen Welt abspielt. Diese Betrugsform ist insofern besonders hinterhältig, als dass sie nicht nur leere Konten, sondern auch gebrochene Herzen hinterlässt.
Betrüger und Betrügerinnen geben sich unter falschen Identitäten in Partnerbörsen und in sozialen Netzwerken als verliebte Verehrerinnen und Verehrer aus. Sie umwerben die Opfer mit Komplimenten und Liebesschwüren und versuchen anschliessend, ihnen mit rührseligen Geschichten Geld aus der Tasche zu ziehen.- Zahlen Sie niemals eine Kaution mit Hilfe eines Geldtransfer-Services, ohne vorher einen gültigen Mietvertrag in der Hand zu halten und das Objekt besichtigt zu haben.
- Ignorieren Sie Wohnungsinserate, in welchen der Besitzer im Ausland weilt und Ihnen gegen ein Depot den Schlüssel zur Besichtigung zukommen lassen will.
- Ignorieren Sie Wohnungsinserate, durch welche Sie erfahren, dass der (ausländische) Besitzer Ihnen die Wohnung ohne vorgängige Besichtigung gegen eine Kaution überlassen möchte.
- Ignorieren Sie Wohnungsinserate, die zu schön sind, um wahr zu sein.
- Kontaktieren Sie den Vermieter. Fragen Sie nach weiteren Informationen, die nicht im Inserat aufgeführt sind. Ein Telefonanruf kann viele Fragen klären und womöglich Betrüger und Betrügerinnen entlarven.
- Bitten Sie den Vermieter um einen Mietvertrag, wenn Sie eine Ferienwohnung buchen möchten ausserhalb des Internetportals. Lesen Sie diesen aufmerksam durch, bevor Sie ihn unterschreiben. Beachten Sie zudem, dass jeder Vermieter seine Zahlungs- und Stornierungsbedingungen selbst festlegen kann.
- Wählen Sie eine sichere Zahlungsmethode. Benutzen Sie den Zahlungsservice, der vom jeweiligen Internetportal vorgeschlagen wird.
- Zahlen Sie niemals im Voraus oder mittels Geldtransfer-Services, wie Western Union oder Moneygram.
- Lesen Sie die Bewertungen über die betreffende Ferienwohnung sorgfältig durch und achten Sie dabei auf deren Glaubwürdigkeit.
- Seien Sie misstrauisch bei Fahrzeug-Inseraten, die zu gut klingen, um wahr zu sein. Typische Erkennungsmerkmale von Betrugsversuchen in diesem Bereich sind:
- ein ungewöhnlich attraktiver Preis;
- Inserate mit wenigen oder unvollständigen Angaben zu Fahrzeug und Verkäufer;
- der Verkauf eines sehr seltenen Modells oder eines Liebhaberobjekts;
- ein Zeitdruck beim Kauf wird erzeugt (z.B. «das Angebot gilt nur noch bis morgen»);
- Inserate mit Katalogbildern statt «echten» Fotos des Fahrzeugs;
- das Fahrzeug oder der Verkäufer ist (angeblich) im Ausland und vor allem;
- die Bitte nach einer Vorauszahlung, ohne dass das Fahrzeug besichtigt oder Probe gefahren wurde.
- Wenn Sie das Gefühl haben, es handle sich um ein betrügerisches Inserat, nehmen Sie keinen Kontakt auf mit den Verkäufern oder brechen Sie den Kontakt umgehend ab.
- Leisten Sie in keinem Fall eine Vorauszahlung schon gar nicht mittels Geldtransfer-Services, wie Western Union oder Moneygram.
- Benutzen Sie für die Zahlung eines online gekauften Fahrzeuges, immer die vom Internetportal vorgeschlagene Zahlungsmethode resp. wickeln Sie das Geschäft über die Plattform ab.
- Versenden Sie keine Kopien von persönlichen Dokumenten, wie Pass, ID, Führer- oder Fahrzeugausweis, an die Verkäufer, auch wenn Sie danach gefragt werden. Betrüger und Betrügerinnen können diese Dokumente für weitere Betrugsversuche verwenden.
- Melden Sie betrügerische Angebote der Verkaufsplattform.
- Seien Sie misstrauisch bei Fahrzeug-Inseraten, die zu gut klingen, um wahr zu sein. Typische Erkennungsmerkmale von Betrugsversuchen in diesem Bereich sind:
Bei falschen Unterstützungsanfragen geht es den Betrügern und Betrügerinnen vor allem darum, an die Mailkonten von Dritten zu gelangen und in deren Namen eine finanzielle Unterstützungsanfrage an alle Personen aus deren Adressbuch zu versenden.
Hierbei übernehmen die Betrüger und Betrügerinnen mit Hilfe eines Hacking– oder Phishing-Angriffs als erstes die Kontrolle über das E-Mail-Konto einer Person. Das Ziel dieser Aktion ist es nun, sämtliche Kontakte aus dessen Adressbuch zu kopieren und im Namen der Person an alle Kontakte eine Notfall-E-Mail zu verschicken. In dieser E-Mail erfinden die Betrüger und Betrügerinnen einen bestimmten Notfall, wie zum Beispiel eine finanzielle Notlage in den Ferien oder während einer Auslandsreise, währenddessen nicht nur das ganze Geld, sondern auch noch deren Reisedokumente gestohlen wurden. Am Schluss der E-Mail bittet die Person nun ihre Kontakte um Hilfe und fragt sie nach einem gewissen Geldbetrag für die Begleichung der offenen Flug- und/oder Hotelrechnung. Ohne die Bezahlung dieser Rechnungen könne die Person ansonsten nicht nach Hause reisen. Die Betrüger und Betrügerinnen bitten die Kontakte nun inständig, das Geld mit Hilfe eines Geldtransfer-Services zu überweisen. Sobald das Geld überwiesen wurde, hört man nichts mehr von der Person und das Geld ist weg.
Wer auf Betrügerinnen und Betrüger hereingefallen ist, sollte sich nicht schämen, die Polizei zu informieren. Betrügerinnen und Betrüger gehen teilweise sehr raffiniert vor, und jede und jeder kann unter Umständen zum Opfer werden. Obwohl es in vielen (vor allem Online-)Betrugsfällen unwahrscheinlich ist, verlorenes Geld zurückzuerhalten, sollte man trotzdem bei der Polizei Anzeige erstatten. Auch diejenigen, die im letzten Moment das Täuschungsmanöver einer Betrügerin oder eines Betrügers erkannt haben, sollten sich umgehend bei der Polizei melden, auch ein Betrugsversuch ist strafbar!
Auch wenn es, wie gesagt, vor allem bei Internetdelikten für die Polizei kaum möglich ist, an die Hintermänner und –frauen zu gelangen, da meist aus der Anonymität agiert wird, sollten diese Internetdelikte angezeigt werden. Nur so erhält die Polizei Informationen zum Ausmass des Deliktsfeldes, kann Zusammenhänge herstellen und allenfalls Ermittlungsansätze finden. Ausserdem kann die Polizei feststellen, mit welchen Tricks Leute betrogen werden. Mit diesem Wissen können die kantonalen und städtischen Polizeikorps gezielt Prävention betreiben und besonders gefährdete Bevölkerungsgruppen vor diesen Tricks warnen.
Dazu müssen relevante Beweismittel, welche den Betrug belegen, gesichert werden: Screenshots der betrügerischen Accounts, das Chatprotokoll und/oder den E-Mail-Verkehr. Anzeige kann bei jeder Polizeistelle erstattet werden.
- Skimming
Der Begriff Skimming wird vom englischen Wort «to skim» abgeleitet, was so viel bedeutet wie «abheben» oder «abschöpfen». Als Skimming bezeichnet man das Manipulieren von Kartenautomaten (Geldautomaten, Billettautomaten und Zahlterminals im Detailhandel, an Tankstellen, in der Gastronomie usw.). Dabei bringen die Täter spezielle Apparaturen am oder im Automaten an, welche die Magnetstreifendaten von Konto-, Debit- und Kreditkarten kopieren und den PIN-Code ausspähen. Mit diesen Informationen kann die Täterschaft anschliessend unbemerkt Geld vom Konto des Opfers abheben. Die meisten Opfer bemerken die Tat erst, wenn sie ihren Kontoauszug prüfen.
- Die Täterschaft bringt als erstes verschiedene Apparaturen im oder am Kartenautomaten an: Ein Kartenlesegerät speichert die Magnetstreifendaten und gleichzeitig spioniert die von der Täterschaft angebrachte Tastaturattrappe oder eine installierte Minikamera den PIN-Code aus. Für den Karteninhaber sind diese Manipulationen praktisch nicht zu erkennen, da die Apparaturen täuschend echt aussehen und die Kameras so klein sind, dass sie kaum bemerkt werden.
- Hat die Täterschaft die benötigten Karteninformationen erlangt, fertigt sie damit anschliessend eine Kopie der Karte an. Da sie die Kartenkopie in der Schweiz ohne Chip nicht nutzen kann, bezieht sie damit im Ausland so viel Geld wie möglich zulasten des ahnungslosen Karteninhabers.
- Es kann aber auch sein, dass Skimming-Betrüger den PIN-Code und Magnetstreifendaten einzig deshalb ausspähen, um mit diesen Informationen zu handeln. Das bedeutet, dass sie via Internet die Daten an andere Betrüger verkaufen, damit diese anschliessend im Ausland illegal Geld von den betroffenen Konten abheben können.
- Geben Sie Ihren PIN-Code niemals an andere Personen weiter. Bewahren Sie den PIN-Code nicht zusammen mit der Karte auf und vermerken Sie ihn nicht auf der Karte.
- Geben Sie an allen Kartenautomaten Ihren PIN-Code verdeckt ein. Verdecken Sie Ihre Zahlen-Eingabe mit der anderen Hand oder mit Ihrem Portemonnaie. Achten Sie darauf, dass Sie niemand dabei beobachtet.
- Lassen Sie sich beim Geldabheben, Bezahlen oder Billett lösen nicht ablenken. Fordern Sie zu nahe tretende Personen auf, Abstand zu halten. Lassen Sie sich nicht in ein Gespräch verwickeln und nehmen Sie keine Hilfe unbekannten Personen an, wenn zum Beispiel Ihre Karte im Automaten feststeckt.
- Vertrauen Sie auch am Kartenautomaten Ihrer Intuition: Wenn Ihnen ein Automat verdächtig vorkommt oder Sie sich am Automaten unwohl fühlen, weil zum Beispiel dubiose Personen in der Nähe sind, jemand Sie anspricht oder Ihnen zu nahe kommt, brechen Sie den Bezahl- oder Geldabhebevorgang ab und suchen Sie sich einen anderen Automaten.
- Geben Sie Ihre Karte nie aus der Hand – weder einem Helfer beim Geldautomaten noch einem Serviceangestellten. Die Karte kann blitzschnell ausgetauscht werden, ohne dass Sie es merken.
- Lassen Sie Ihre Karte bei Verdacht auf Missbrauch umgehend sperren. Das Gleiche gilt bei Diebstahl, Verlust oder Einzug der Karte am Automaten.
- Falls Sie einen manipulierten Automaten entdecken, informieren Sie den Automatenbetreiber. Ausserhalb der Bürozeiten wenden Sie sich an die Polizei über die Notrufnummer 117. Sie helfen so, weiteren Schaden zu vermeiden.
- Überprüfen Sie regelmässig Ihren Kontoauszug und kontaktieren Sie bei Unstimmigkeiten sofort Ihr Finanzinstitut.
Nutzen Sie die Card-Control im Ausland. Darunter versteht man die Einschränkung der Kartennutzung im Ausland. Um sich vor Skimming zu schützen, sind folgende Massnahmen besonders effektiv:
- Geoblocking/Geocontrol: Die Karte kann nur in ausgewählten Ländern eingesetzt werden.
- Beschränkung der Bezugslimite: Die maximale Bezugslimite der Karte im Ausland wird eingeschränkt.
- Mischform: Die maximale Bezugslimite ist auf ausgewählte Länder beschränkt.
Card-Control kommt bei den Finanzinstituten unterschiedlich zum Einsatz. Auch die Länderselektion erfolgt nicht einheitlich. Je nachdem entscheidet das Finanzinstitut, der Kunde oder die Kundin, wo die Karte im Ausland eingesetzt werden kann. Wenden Sie sich für mehr Informationen direkt an Ihr Finanzinstitut.
- Wenn Sie bemerken, dass ein Kartenautomat manipuliert ist, kontaktieren Sie den Automatenbetreiber und ausserhalb der Öffnungszeiten die Polizei über die Notrufnummer 117. Befolgen Sie die Weisungen der Polizei und verändern Sie nichts am möglichen Tatort, bis diese eintrifft. Lassen Sie sich in dieser Zeit nicht von fremden Personen helfen.
- Lassen Sie Ihre Karte umgehend sperren, wenn Sie Ihre Karte verloren haben, Ihre Karte gestohlen wurde, Ihre Karte vom Kartenautomaten nicht mehr herausgegeben wird, der Verdacht auf Missbrauch besteht oder Sie – in Rücksprache mit Ihrem Finanzinstitut – missbräuchliche Bezüge auf Ihrem Kontoauszug feststellen.
- Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei, wenn Ihre Karte gestohlen wurde oder Ihnen Ihr Finanzinstitut bei unberechtigten Abbuchungen dazu rät.
- Abzocke
Fokus Einbruch
- Einbruch
Wenn die Täterschaft sich gewaltsam Zutritt verschafft, indem sie zum Beispiel eine Türe aufbricht oder eine Scheibe einschlägt, spricht man von Einbruchdiebstahl. Wenn Türen oder Fenster offen stehen und eine Einbrecherin oder ein Einbrecher ohne Gewaltanwendung zu den Wertsachen vordringt und diese an sich nehmen kann, handelt es sich um einen Einschleichdiebstahl.
Einbrecherinnen und Einbrecher kommen dann, wenn niemand da ist. Sie dringen meist tagsüber in Wohnungen und Einfamilienhäuser ein, wenn die Leute arbeiten und unterwegs sind. In Geschäftsräumen, Büros, Lagerhallen und dergleichen finden Einbrüche häufiger nachts statt, wenn sich niemand mehr in den Räumlichkeiten oder auf dem Gelände aufhält.
Einbrecherinnen und Einbrecher gehen der Konfrontation mit Bewohnerinnen und Bewohnern aus dem Weg. Wenn Sie während ihrer Tat hören oder sehen, dass jemand die Wohnung oder die Geschäftsräume betritt, machen sie sich meist sofort aus dem Staub.
Sie wählen immer den Weg des geringsten Widerstandes. Weil viele Leute ihre Wohn- und Geschäftsräume zu wenig sichern, steigen sie beispielsweise durch offene Kellerfenster oder Terrassentüren ein (Einschleichdiebstahl). Die meisten Einbruchdiebstähle werden mit einfachen Werkzeugen wie Schraubenzieher oder Stemmeisen verübt, die in jede Jackentasche passen.
Menschen, die Einbrüche begehen, sind nicht immer männlich und dunkel gekleidet. Auch Frauen, Jugendliche und sogar Kinder begehen Einbrüche und um nicht aufzufallen, kleiden sie sich alle so unauffällig wie möglich. Potenzielle Einbrecherinnen und Einbrecher kann man teilweise an ihrem Verhalten erkennen, etwa dann wenn sie ein Haus und seine Umgebung auskundschaften oder in einem Quartier umherstreifen.
Bei einer Sicherheitsberatung besichtigen polizeiliche Expertinnen und Experten eine Liegenschaft oder eine Wohnung und geben danach Empfehlungen ab, wie und an welchen Stellen die Einbruchshemmung verbessert werden könnte. Diese Beratungen sind in den allermeisten Kantonen kostenlos.
- Schliessen Sie Türen immer mit Schlüssel ab, auch bei kurzen Abwesenheiten.
- Schliessen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster! Einbrecherinnen und Einbrecher können mit etwas Fingerfertigkeit und ohne Gewaltanwendung gekippte Fenster öffnen.
- Eine der wirksamsten Hürden, die Sie gegen Einbrecherinnen und Einbrecher aufstellen können, ist eine gute Nachbarschaft. Je weniger sich Nachbarinnen und Nachbarn gegeneinander abschotten und je mehr sie einander vertrauen, desto grösser wird die Bereitschaft sein, immer auch auf das Eigentum oder die Wohnung nebenan ein wachsames Auge zu haben. Informieren Sie Ihre Nachbarn ausserdem über ihre Ferienabwesenheiten. Wenn Ihre Nachbarn wissen, dass niemand zu Hause sein sollte und sie dennoch Geräusche aus Ihrer Wohnung oder Ihrem Haus wahrnehmen bzw. Licht sehen, werden sie schnell an einen Einbruch denken. Wenn Sie längere Zeit verreist sind, sollte sich jemand um Ihre Post kümmern, denn ein überquellender Briefkasten signalisiert Einbrecherinnen und Einbrechern, dass Sie verreist sein könnten.
Sollten Sie einen Einbrecher oder eine Einbrecherin zufällig «auf frischer Tat» ertappen, versuchen Sie auf keinen Fall, sie oder ihn zurückzuhalten oder sogar zu überwältigen! Ziehen Sie sich schnell zurück und rufen Sie die Polizei (117). Merken Sie sich, wie die Personen ausgesehen haben, welches Fahrzeug benutzt wurde und in welche Richtung sie sich entfernten. Versuchen Sie das Kontrollschild zu erkennen, aber bringen Sie sich dabei selbst nicht in Gefahr!
Wichtige Hinweise auf die Täterschaft könnten verloren gehen. Warten Sie deshalb ausserhalb der Wohnung auf die Polizei.
In Faltblatt «Einbruch – Was nun?» finden Menschen, die Opfer eines Einbruchs geworden sind, Informationen zum Vorgehen der Polizei sowie fünf praktische Tipps, die ihnen dabei helfen, den Einbruch so schnell wie möglich zu verarbeiten.
- Einbruch
Diebstahl
- Diebstahl
So verschieden wie ihre Beute, ihre Vorgehensweisen und ihre bevorzugten «Arbeitsorte», so verschieden sind die Diebinnen und Diebe selbst: Männer und Frauen, Jugendliche und sogar Kinder; Menschen im Anzug, in Handwerkskleidung oder im Partyoutfit, mit Wanderrucksack, Aktenkoffer oder Kinderwagen; Menschen, die betrunken, verwirrt oder sehr hilfsbereit wirken, scheinbar als Touristen in der Schweiz sind oder so tun, als wären sie entfernte Verwandte des Grossvaters.
- Sichern Sie Ihr Velo immer mit einem geprüften Sicherheitsschloss.
- Befestigen Sie den Rahmen Ihres Velos so an einem im Boden verankerten Gegenstand (z.B. Zaun, Pfosten), dass es nicht ausgefädelt und davongetragen werden kann.
- Velos können auch in Gruppen zusammengeschlossen werden.
- Bewahren Sie das Velo nach Möglichkeit in einem verschlossenen oder überwachten Raum auf.
- Vergessen Sie nicht, Ihr Velo zu sichern, wenn Sie es auf dem Autodach oder am Heck des Autos transportieren.
- Notieren Sie sich die Rahmennummer, Marke und Farbe Ihres Velos. Am besten nutzen Sie die Dienstleistungen eines Anbieters wie Velofinder.
Auch wenn man sein Velo bestmöglich sichert, kann es passieren, dass es Diebinnen und Dieben in die Hände fällt. Melden Sie den Diebstahl umgehend der Polizei! Sie benötigen dazu die Rahmennummer Ihres Velos, Marke/Typ, Farbe, den Namen Ihrer Hausratsversicherung sowie einen gültigen Personalausweis. In 12 Kantonen können Sie einen Velodiebstahl auch im Internet anzeigen.
- Lassen Sie keine Ihnen unbekannte Person in die Wohnung, vor allem dann nicht, wenn Sie alleine in der Wohnung sind.
- Benützen Sie immer Sperrbügel und Spion, wenn es klingelt oder schauen Sie aus dem Fenster, so finden Sie heraus, wer vor Ihrer Tür ist, ohne die Türe (ganz) zu öffnen.
- Wenn jemand z.B. vorgibt, für die Gemeinde zu arbeiten oder im Auftrag der Hausverwaltung Handwerksarbeiten erledigen zu wollen, verlangen Sie einen Ausweis und erkundigen Sie sich telefonisch bei der Gemeinde bzw. der Hausverwaltung. Aber Achtung: Suchen Sie die entsprechende Telefonnummer immer selbst im Internet oder im Telefonbuch und lassen Sie sich von der Person an Ihrer Haustüre nicht irgendeine Handy-Nummer geben. Ein Komplize könnte unter der Handy-Nummer einen Mitarbeiter der Gemeinde oder der Hausverwaltung «spielen». Schliessen Sie ausserdem die Tür, bis Sie abgeklärt haben, ob die Person wirklich im Auftrag der Gemeinde bzw. der Hausverwaltung vorbeikommt.
- Lassen Sie im Zweifel eine Person nicht ins Haus. Riskieren Sie lieber unhöflich und misstrauisch zu sein, als sich bestehlen zu lassen. Sie können sich ja im Nachhinein immer noch entschuldigen bzw. einen neuen Termin mit dem Handwerker oder der Behördenvertreterin vereinbaren.
- Tragen Sie Ihr Portemonnaie, Smartphone und Ihre Hausschlüssel auf der Innenseite Ihrer Kleidung, am besten in verschliessbaren Innentaschen.
- Tragen Sie Hand-, Schulter- und Umhängetaschen an der verkehrsabgewandten Körperseite.
- Nehmen Sie Ihre Wertsachen nur wenig nötig in die Hand und stellen Sie sie nicht zur Schau.
- Führen Sie Botengänge mit hohen Geldwerten nie alleine aus.
- Meiden Sie schlecht beleuchtete und kaum frequentierte Wege.
- Falls jemand versucht, Ihnen Ihre Wertsachen zu entreissen, wehren Sie sich nicht. Sie könnten sich verletzen.
- Dort, wo sich Touristen und Touristinnen sowie Reisende aufhalten (Bahnhof, Flughafen, Märkte etc.)
- Dort, wo man sich leicht unter die Gäste mischen kann (Gastgewerbe)
- Dort, wo Menschen nicht (mehr) selbst, auf ihre Wertsachen achten können (Heime, Spitäler)
- Dort, wo Menschen trainieren und Sport betreiben
- Dort, wo Menschen feiern und häufig alkoholisiert sind (Clubs, Bars, Konzerte, Open Airs, Sportevents etc.)
Wenn die Polizei Diebesgut beschlagnahmt oder findet, versucht sie es mit Hilfe der Datenbankeinträge zuzuordnen und der Besitzerin oder dem Besitzer zurückzugeben.
Wer Opfer von Taschendieben oder Trickdieben wurde, hat jedoch allgemein geringe Aussichten, seine Wertsachen zurückzuerhalten. Es ist dennoch wichtig, Diebstähle der Polizei zu melden. Sie kann so feststellen, in welchen Gebieten sich derzeit besonders viele Diebinnen und Diebe aufhalten und mit welchen Tricks derzeit viele Leute bestohlen werden. Mit diesem Wissen können die kantonalen und städtischen Polizeikorps gezielt Prävention betreiben und besonders gefährdete Bevölkerungsgruppen warnen sowie ihre Präsenz an bestimmten Orten verstärken.
- Diebstahl
Diese Seite verwendet Cookies. Erfahren Sie in unserer Datenschutzerklärung mehr darüber, wie wir Cookies einsetzen und wie Sie Ihre Einstellungen ändern können: Datenschutzerklärung
